Synopsis
Zynismus, Feigheit, zumindest aber Weltfremdheit wird dem Pazifismus seit jeher vorgeworfen und der Grimm, mit dem ihm derlei Vorwürfe gemacht werden, schwillt über jedes Maß, sobald ein Krieg erst ausgebrochen ist. Man kennt’s. Andererseits: Sieht man auf die Zwecke, mit denen Kriege begonnen werden, scheint der Pazifismus einen erstaunlichen Siegeszug hingelegt zu haben; ganz weltfremd kann er nicht sein: War es dereinst, zu Zeiten von Sumer oder Ägypten, gebräuchlich, Raub und Brandschatz als Ziel und Zweck von Kriegen anzugeben, wurden sie später nur noch aus religiösen, dann aus völkischen und kulturellen Gründen angezettelt. Heute werden Kriege ausschliesslich aus humanistischen Gründen geführt, etwa um Schlimmeres zu vermeiden, um Menschen zu befreien, Kriege zu beenden usw. Wie soll man das Hochschrauben der Kriegsgründe in immer menschenfreundlichere und barmherzigere Sphären deuten, wenn nicht als Siegeszug des Gedankens, dass Kriege eigentlich abscheulich seien, ihr Führen ein Verbrechen und schon die Absicht zu ächten?
Der vorliegende Aufsatz widmet sich der Zerstörung dieses letzten noch übrigen, des humanistischen Kriegsgrundes. Was der Humanismus will, soll demonstriert werden, kann der Krieg nicht leisten. Nicht, weil der Krieg per Definition die Anwendung inhumaner Gewalt bedeutet; derlei Gründe sind schon vielfach ausgeführt und auch von Kriegsbefürwortern nicht bestritten worden. Kriegsbefürworter geben die Gewalt ja zu. Sie wollen eigentlich keine Kriege. Niemand will Kriege. Ausser manchmal. Die Kriegsbefürworter sehen Kriege als bedauerliche, aber notwtwendige Ausnahme, um zur Regel zurückkehren zu können; als leider unvermeidliche Roßkur, um das Übel auszutreiben; kurz, als rabiates, aber zweckrichtiges Mittel, um den Humanismus schnellstmöglich wieder herzustellen.
Die Idee des Ausnahmemachens vom Humanismus, um zu ihm zurückkehren zu können, wird hier überprüft. Mein Argument geht von einem Humanismus-Begriff aus, den ich aus der Geschichtsauffassung Hegels extrapoliere. Aus der folgt unmittelbar, dass das Führen von Kriegen — insbesondere jenen, die das Verschieben von Staatsgrenzen bezwecken — nie etwas von dem bewegt hat oder auch prinzipiell bewegen könnte, was Humanismus und zivilisatorischer Fortschritt meinen. In seiner praktischen Konsequenz zielt das Argument eher auf die Beschaffenheit des zivilen Friedens, insbesondere auf die universelle Abschaffung des Kriegsrechtes, denn auf Handlungsoptionen nach dem Ausbruch von Kriegen. Trotzdem ist der in diesem Aufsatz entwickelte Standpunkt geeignet, nachzuweisen, dass die meisten Kriege, die aus humanistischen Gründen geführt wurden, in Wahrheit furchtbare Irrtümer waren, die ihr Ziel nicht erreichten und nie erreichen konnten. Auch das Argument, der Ausgang des zweiten Weltkriegs liefere eine empirische Rechtfertigung für das Führen von Kriegen zu humanistischen Zwecken, wird kritisiert. Am Ende behandelt der Aufsatz noch die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine.
Intro
Krieg ist fast immer. Seit aber Russland die Ukraine überfallen hat, ist er nicht nur gegenwärtig, sondern auch gewärtig. Seit dieser Krieg anhob, geht es auch hierzulande nurmehr um Waffenlieferungen, um Flüchtlingshilfe, um Aufrüstung, Raketenstationierungen und Wehrpflicht, um Gaspreise und Inflation; um Atomdrohungen, Sanktionen und um aussenpolitische Bündnisse und Abhängigkeiten. Die Kriegstrommel gibt den Rhythmus vor und ist das Hauptinstrument der Jetztzeit. Sie übertönt Corona, Klimadebatten, Cancel Culture und sogar den Radau um die Wiederkehr des Faschismus. Das Ganze ist begleitet von massiven ideologischen Kämpfen um Deutungshoheiten entlang der verschiedenen Linien des Konfliktes; hauptsächlich natürlich um die Ursachen und Vorgeschichten des Krieges, mit anderen Worten, um die Schuld.
Ein eher mittelbeachteter Nebenschauplatz dieser ideologischen Scharmützel betrifft den Pazifismus. Im Zuge des Kampfgetümmels hat der Pazifismus (naturgemäß) eine besonders feindselige und abschätzige Behandlung erfahren. Über Nacht entstand das Kampfwort vom „Lumpenpazifisten“ und Bertha von Suttners ehrbares „Die Waffen nieder!“ war plötzlich verschrieen als Losung der Niedertracht und des Verweigerns von Mitgefühl und Solidarität mit den Überfallenen, Bedrängten und Geschundenen.
Hier soll nicht Platz sein, alle Vorwürfe zu behandeln, die dem Pazifismus in diesen Monaten zur Last gelegt wurden; es war auch meistenteils das Übliche: zB. der Pazifismus wäre nicht nur weltfremd und praxisfern, sondern darüber hinaus auch menschenverachtend und zynisch. Was in der Theorie dem christlichen Ideal der Nächstenliebe ähnele, verkehre sich in der wahren Welt, in der ein Staat einen anderen überfällt, in sein gerades Gegenteil. Gemäß dem Wort, das „Gegenteil von gut ist gut gemeint“, würde der Pazifismus dazu führen, dass zwischen Staaten nurmehr das „Recht des Stärkeren“ herrschen würde, das natürlich in Wirklichkeit gar kein Recht sei, sondern Unrecht. Der Pazifist — irgendwann geht es fast immer ad hominem weiter — der Pazifist wäre deshalb bei Lichte betrachtet ein selbstsüchtiger Moralist, dessen politische Einstellung nur der Rettung des eigenen erbärmlichen Seelenheils diente. Um des Trostpreises eines Gefühls moralischer Sauberkeit, wo nicht der Illusion von Überlegenheit, würde er sich von dem abwenden, was in der Wirklichkeit zu tun sei: Nämlich den bewaffneten Kampf gegen den Aggressor zu führen, bis diesem — so blutig es dabei nunmal leider zugehen müsse — ein für alle mal eingetrimmt sei, dass einen Krieg zu beginnen unweigerlich zu Selbstverletzung, Schmach und Niederlage führte. Frieden sei einmal (abermals: leider) in der wahren Welt immer nur als Folge gewonnener (oder verlorener) Kriege zu haben.
So (oder so ähnlich) lauteten die üblichen Zeihungen gegen den Pazifismus in den letzten Monaten. Und so (oder so ähnlich) haben sie eigentlich schon seit Bertha von Suttner und Ludwig Quidde gelautet. Was bedeuten soll, dass natürlich bereits eine Reihe guter Argumente gegen die oben gebrachten Vorwürfe ausgearbeitet wurden. Die meisten von denen zielen darauf ab, den zweckrationalen Kern des Pazifismus zu beweisen und zu verteidigen. Der Pazifismus sei gerade kein selbstsüchtiger Standpunkt, der der Herstellung eines Gefühls moralischer Sauberkeit diene, sondern eine ernsthafte verantwortungsethische Richtlinie zur Minimierung von Schaden und Leid. Diese Argumente sind, wie gesagt, oft gar nicht schlecht; und sei es nur, weil sie Versachlichung in eine Debatte bringen, die normalerweise rasant in Zorn und Rauch entflammt. Andererseits sind solche Argumente auch oft unbefriedigend, weil sie nicht selten in ein scheinbar unentscheidbares Vorzeigen von Gründen für die Priorisierung von Werten münden. Beispielsweise sei dem einen eben das Leben eines Menschen wichtiger, dem anderen die Möglichkeit, dieses Leben in Freiheit zu führen; und wer wollte dazwischen ernsthaft abwägen oder gültig entscheiden?
Wiewohl ich nicht glaube, dass tatsächlich eine Patt-Situation vorliegt (der moderate, pragmatische Pazifist hat m.E. in der Regel die besseren Argumente, weil das Leben selbst nunmal die Voraussetzung für das Aufkommen und Durchsetzen aller Werte ist), will ich in diesem Aufsatz eine ganz andere, wie ich meine weniger bekannte Rechtfertigung des Pazifismus vortragen. Sie kommt nicht aus Theorien des Handelns und Sollens, sondern aus Theorien der Geschichte, des Fortschritts und des Sinns oder Unsinns staatlicher Einrichtungen und Institutionen. Zu meinem Ausgangspunkt habe ich Hegel erkoren; es ist ein willkürlich gesetzter Ausgangspunkt, aber kein schlechter.
Die Idee eines „zivilisatorischen Fortschrittes“ wird zentral sein und mein Argument wird lauten, dass Kriege sehr viel weniger für den zivilisatorischen Fortschritt leisten können, als gemeinhin angenommen. Ich greife also den Krieg in diesem Argument weniger aus Gründen an, die mit seinen desaströsen Folgen und Konsequenzen zu tun haben; als aus Gründen, die mit seinen Motiven und den Zwecken zusammenhängen, aus denen moderne Kriege überhaupt begonnen und gerechtfertigt werden.
Genauer will ich einmal herausarbeiten, dass Kriege in der Regel nicht das zweckrichtige Mittel sind, die mit ihm offiziell verbundenen Ziele zu erreichen; und insbesondere dann nicht, wenn diese Ziele humanistisch sind und „Befreiung“ oder „Herstellung von Gerechtigkeit“ heissen. Das Argument, das ich aus einem allgemeinen geschichtsphilosophischen Standpunkt ableite, legt nahe, dass Kriege oft nicht mehr als schreckliche Irrtümer sind und waren; anstatt, wie oft gegen den Pazifisten behauptet, notwendige Grundlage eines späteren, dauerhaften Friedens. Ich halte dafür, dass die Menschheit nur eben psychologisch nicht in der Lage ist, sich die fundamentale Irrtümlichkeit von Kriegen einzugestehen, weil es natürlich all die furchtbaren Opfer, die in Kriegen gebracht wurden, fragwürdig und sinnlos macht. Das betrifft in der Regel sogar die Opfer beider Seiten, die der Aggressoren, wie die der Angegriffenen; als auch die der Sieger und Verlierer, wenn es denn überhaupt Sieger gab.
Es ist an der Zeit, die fortgesetzte Geschichte dieser Irrtümer wenigstens als Möglichkeit anzusprechen. Und natürlich schreibe das mit voller Absicht jetzt, in einer Gegenwart, in der wir uns an den Krieg gewöhnen und in der imperiales und territoriales Denken wieder aufersteht und auf ein weitgehend unvorbereitetes Publikum trifft. Imperiale und revanchistische Gedanken waren ja gottseidank für viele Jahrzehnte aus der Mode und bedürfen nun, da sie wieder in Schwang kommen, einer grundsätzlichen Zurückweisung. Deshalb.
(1) Frieden ist nicht Gewaltlosigkeit. Zivile Gewalt vs. militärische Gewalt.
Beginnen wir mit dem Frieden. Dem Pazifismus wird oft vorgeworfen, die Gewaltlosigkeit, die er anstrebe, ginge zu weit und sei weltfremd. Er romantisiere den Frieden als „gewaltlosen Zustand“; aber das sei der in Wirklichkeit gar nicht.
Natürlich kommt auch im schönsten Frieden allerhand Gewalt vor: Amokläufer laufen Amok, Mörder morden, Eltern schlagen Kinder, Ehemänner verprügeln ihre und andere Frauen, Menschenhändler handeln und mißhandeln Sklaven, Nazis zünden Flüchtlingsheime an und Polizisten verprügeln oder ermorden Demonstrantinnen und andere ihnen eigentlich Schutzbefohlene. Diese Normalität nennen sowohl Pazifisten, als auch Nicht-Pazifisten „Frieden“ und finden sie erstrebenswert. Warum eigentlich?
Selbstredend finden weder Pazifistinnen noch ihre Gegnerinnen diese „zivile Gewalt“ erstrebenswert; sie ist nur eben das, was an Gewalt für gewöhnlich in einem Staate übrig bleibt, wenn er gerade keinen Krieg mit anderen Staaten führt. So lässt sich der Frieden in etwa verstehen, negativ, als Abwesenheit von Kriegen und insbesondere solcher zwischen Staaten. Viel mehr Gutes lässt sich von ihm leider (noch?) nicht sagen.
Andererseits ist das auch nicht wenig. So ein Krieg zwischen Staaten ist ja nicht nur dieser Krieg. Krieg bedeutet nicht nur, dass Soldaten einander totschiessen und massakrieren und Zivilisten ermorden und Städte und Dörfer und Natur vernichten, sondern er bedeutet über das unmittelbar zerstörerische Geschehen hinaus den „Ausnahmezustand“ für die gesamte zivile Gesellschaft. Also (in no particular order): Gewöhnung an das Töten, wo nicht Beklatschen der Opfer des „Feindes“; Indenkriegziehen bzw. -ziehenmüssen der jungen (oft auch der älteren) Männer & deren Verrohung und Traumatisierung; permanente Verängstigung und Bedrohung der Zivilbevölkerung bis sie ganz irre vor Angst wird (was ihre antidemokratischen und Herden-Reflexe stärkt, bzw. die Fähigkeit schwächt, andere Meinungen auszuhalten); Trimmen der Wirtschaft auf Kriegswirtschaft und massiver Ankauf von Waffen (Geld, das für soziale und zivile Einrichtungen fehlt), Monokultur des politischen Diskurses (ie. es gibt kein anderes Thema, oft nichtmal eine andere Meinung); kurz, die gesamte Innenpolitik wird von einem Krieg sodomisiert und vollkommen verdorben. Die Gewalt des Krieges addiert sich deshalb nicht einfach zur Gewalt des Friedens hinzu, sondern ersetzt sie durch eine andere, vielfach brutalere Realität. Auch die zivile Gesellschaft wird im Krieg militarisiert und es dauert viele Jahre, bis sie sich vom Kriegszustand erholt und ihre seelische, wirtschaftliche und politische Versehrtheiten halbwegs vernarbt sind.
Die Vermeidung bzw. Verhinderung einer derart deformierten und deformierenden Normalität ist mindestens ebenso Ziel der Pazifisten, wie das Verhindern des Krieges selbst. Sie träumen kein Eiapopeia, in dem alle einander lieb haben usw.; das ist ein Strohmann-Ziel, das keine Pazifistin je für verwirklichbar hielt. Das Paradies haben die Christen erfunden, nicht die Pazifisten.
(2) Wenn es einen Fortschritt in der Geschichte gibt, dann betrifft er vor allem die zivile Gewalt.
Wir wollen also mit der Feststellung beginnen, dass der Frieden mit seinem Residuum der „zivilen Gewalt“ zwar kein Idealzustand ist, aber ein unendlich viel besserer, als der des Krieges. Das klingt selbstverständlich, ist es aber, wie wir später sehen werden, nicht unbedingt. Die meisten Kriegsbefürworter sind denn auch keine Kriegsfreunde, sondern halten dafür, dass der Krieg manchmal ein in Kauf zu nehmendes Übel sei, um den Frieden wieder herzustellen. Mit anderen Worten, sie anerkennen die moralische und praktische Überlegenheit der „zivilen Gewalt“ vor der „militärischen Gewalt“ nur fallweise; es gibt für sie eine Reihe gerechtfertigter Ausnahmen. Meine Absicht richtet sich gegen diesen Hang zur Ausnahme.
Die Idee, dass es manchmal notwendig sei, Kriege zu führen, impliziert, dass Kriege manchmal ein zweckrationales Mittel sind, um bestimmte (erstrebenswerte, moralisch rechtfertigbare) Ziele zu erreichen. In der Neuzeit sind das vor allem die Abwehr eines Aggressors („Verteidigungskrieg“) oder die Befreiung eines Landes von Besatzern oder von unrechtmässigen Herrschern („Befreiungskrieg“ und „Sezessionskrieg“). Der Krieg der Alliierten gegen Nazideutschland scheint ein in dieser Hinsicht besonderes Gepräge zu haben, weil er offiziell nicht nur Befreiung, sondern die Niederwerfung einer ganzen Ideologie und ihrer Verfechter (des Nationalsozialismus und der Nazis) zum Ziel hatte. Auch darauf werde ich zu reden kommen.
Die zentrale Frage, die ich in diesem Aufsatz stelle, lautet nun: Können Kriege eigentlich all das tatsächlich leisten? Können sie Freiheit bringen und Ideologien wie die des Nationalsozialismus niederwerfen? Ganz allgemein: Was leisten Kriege eigentlich, nüchtern und bei Tage besehen? Können sie, wie die fallweisen Kriegsbefürworter gern glauben, die Geschichte sinnvoll voran bringen? Können sie Gerechtigkeit herstellen? Allgemein: Sind Kriege überhaupt mit Fort- und Rückschritt der Menschheit verbunden; und wenn ja, wie?
Erstens: Schaut man von ganz fern auf Kriege (sagen wir, vom Mond aus), dann leisten die meisten Kriege nur eine einzige Sache: Sie verschieben Grenzen und legen Herrschaftsbereiche fest. In ihrem Ergebnis entstehen und verschwinden territoriale Hoheitsgebiete. Kriege verändern nur die geographische Anordnung solcher Herrschaftsgebiete. — Und das ist auch schon alles. Das ist der ganze Lohn von Kriegen (vom Mond aus besehen).
Zweitens: Wenn ein Historiker uns die Menschheitsgeschichte erklären sollte, nur ganz im Groben, und er würde seine Erzählung darin erschöpfen, welche Herrschaftsgeschlechter in welcher Abfolge einander ablösten und welche Reiche und Grenzen wann und wo sich in welchen Schlachten und Scharmützeln verschoben hätten, fänden wir das nicht nur furchtbar trist; wir hätten auch den Eindruck, dass unser Historiker an allem, was uns wichtig an der Menschheitsgeschichte vorkommt, vorbei erzählte: Wie die Menschen nämlich zu diesen Zeiten gelebt hätten, was sie dachten und was ihre Ziele und Antriebe waren, woran sie glaubten, wofür sie stritten, wie sie ihr Zusammenleben organisierten, d.h. welche staatlichen Institutionen sie schufen, über welche technischen Vorrichtungen sie verfügten, welche politischen Vorstellungen existierten und miteinander um Einfluss kämpften etc.
Geschichte, schwant uns, scheint im Wesen etwas ganz anderes zu betreffen, als das Verschieben von Grenzen. Wir wollen keine Orte und Zeiten und kein Who was Who; wir wollen die Geschichte! Uns verlangt zu wissen, was früher anders war und was gleich (und warum). Mit anderen Worten, uns verlangt zu wissen, ob die Menschheit sich entwickelt hätte? Die bedrückende Frage, ob wir uns überhaupt irgend weiter entwickelt hätten, oder letztlich nur Urmenschen mit Internet wären, ist sehr viel älter als das Internet. Es ist die Frage nach dem Fortschritt.
Man versteht sie augenblicks. Es gibt eine leicht nachvollziehbare Warte, von der aus es sehr unerheblich ist, ob ein Herrscher Richard oder Eberhard hiess und ob dessen Reich links oder rechts der Isar verlief. — Nicht für Richard und Eberhard, versteht sich. Für die spielt das eine eminente Rolle. Aus deren Sicht (der jeweils herrschenden Sicht) ist verständlich, wenn sie die ruhmreiche Geschichte ihres Weges zur Macht mit der Geschichte verwechseln. Aber für die Menschheit sind das weitgehend austauschbare Namen und Gestalten. Selbst wenn Richard ein großmütiger und freundlicher Mann, Eberhard jedoch ein willkürlicher und brutaler Despot wäre, beträfe dieser Unterschied doch nicht, was wir meinen, wenn wir danach fragen, wie sich die Menschheit entwickelt, was in ihrer Geschichte an Neuem sich ereignet, und ob oder wie ein Fortschritt sich überhaupt abgespielt hätte oder abspielen könne? Gleiches gilt, das zu ändernde geändert, für den Verlauf von Grenzen. Sie könnten genauso gut anders gezogen sein und erklären weder unser Herkommen, noch unsere Werte oder irgendeinen anderen wichtigen Punkt unseres historischen Selbstverständnisses.
Einer, der die gleiche Skepsis gegen die bis dato vorherrschende Art der Geschichtsschreibung empfand — also, gegen das Geschichtsbild einer mehr oder minder kontingenten Abfolge von Herrschaftsgeschlechtern und mehr oder minder gewaltsamer Grenzverschiebungen — war dieser Hegel. Hegel war gewiss nicht der erste, dem unbefriedigend schien, im Herzählen von Namen, Orten und Jahreszahlen die Essenz der Menschheitsgeschichte zu erblicken. Weil es sich aber leichter merken und verdichten lässt, geben wir ihm einmal die möglicherweise nicht ganz verdiente Ehre, jene einerseits karge und andererseits herrschafts-, gebiets- und gewaltzentrierte (= imperiale) Geschichtsschreibung endgültig fragwürdig gemacht und radikal kritisiert zu haben.
Zumindest kann als gesichert gelten, dass er sich auf die Frage, was überhaupt Geschichte sei, eine neue, originelle Antwort einfallen liess: Geschichte, sagt Hegel sinngemäss, sei der (stufenweise) Fortschritt des Bewusstseins davon, was Freiheit bedeutet. Nennen wir dies einmal die Idee des „zivilisatorischen Fortschritts“.
Nun ist ziemlich interpretationsoffen, was Hegels „Stufengang des Bewusstsein der Bedeutung von Freiheit“ genau bedeuten soll. Diese Mehrdeutigkeit eingeräumt halte ich aber zumindest für ausgemacht, dass sie sich nicht (wie manchmal unterstellt) in einer Bewegung der Anschauung oder des Geistes erschöpft, bzw. in einem Stand der Kenntnisse und Einsichten über die Freiheit. Von Hegel mitgemeint sind mindestens ebenso die Entwicklung der konkreten staatlichen Institutionen, die den Menschen ihre lebensweltliche Freiheit ermöglichen, deren innere Beschaffenheit und Mechanismen, ihr Ansehen und Einfluß im Staat; die Rechte und Gesetze, die in einem Lande gelten und die Modi ihrer Durchsetzung und gegebenenfalls Abänderung oder Verfeinerung; der Kampf, der um Rechte, Privilegien und Gesetze tobt (oder nicht tobt): Kurz, das Gesamt aller tatsächlich vorhandenen Einrichtungen, Traditionen, und Werte, die die Freiheit der Menschen sowohl ermöglichen, als auch beschränken. Deren Wandel durch die Zeit, so möge man den Hegel hier einmal schlicht begreifen, sei Geschichte. Und, sofern die Freiheit der Menschen sich durch solchen Wandel vergrössere (was über längere Zeiten betrachtet, in Hegels Sicht der Fall war), sei dies auch Fortschritt.
Sehen wir, bevor wir mit unserem eigentlichen Pro-Pazifismus-Argument beginnen, kurz auf den Fortschrittsgedanken, den Hegels Vorschlag auch beinhaltet. Er wird oft kritisiert und mit Skepsis betrachtet. Man mag einen Geschichtsoptimismus (oder sogar Geschichtsdeterminismus der in gewisser Weise auch impliziert zu sein scheint) verneinen; und also auch die Idee eines Fortschritts in der Geschichte ablehnen. Tatsächlich habe ich den Verdacht, dass die Ablehnung eines historischen Fortschrittgedankens und die Ablehnung von Pazifismus miteinander verschwisterte Einstellungen sind. Zumindest scheint es leichter zu fallen, Kriege als mehr oder weniger notwendiges Übel zu akzeptieren, wenn man von vornherein keine großen Erwartungen an eine Veränderung, geschweige denn, an eine Verbesserung der Conditio Humana hegt.
Der Zank, ob es einen Fortschritt in der Geschichte gibt, ist alt und hier nur sofern von Belang, als ich dafür plädieren will, dass Hegels Geschichtsphilosophie bei aller möglichen Fortschrittsnaivität des neunzehnten Jahrhunderts einen unschlagbaren Vorteil hat: Sie zielt auf etwas, was auch wir Bewohner des einundzwanzigsten Jahrhunderts viel eher als Geschichte ansehen, als eine Liste von Schlachten, Grenzverschiebungen und Herrschern. Gewiss hat die Idee des Fortschritts durch die zivilisatorischen Rückfälle und Desillusionierungen des zwanzigsten Jahrhunderts und eben just auch durch Russlands Überfall auf die Ukraine vielfach Diskreditierung erfahren. Man kann heute kein naiver Fortschrittsphilosoph mehr sein; aber muss ja auch keiner. Man kann dem Fortschrittsgedanken auch anhangen, ohne zu glauben, dass er sich zwangsläufig oder geradlinig durchsetzt.
Noch einen Einschub an den Rand notiert: Die entscheidende Frage scheint mir gar nicht, ob es sowas, wie einen Fortschritt tatsächlich gibt, sondern, ob es ihn geben sollte. Das verschöbe die Debatte erheblich. Von der Pflicht nämlich, Belege für den Fortschritt zu bringen, zur Pflicht, das Erstrebenswerte am Fortschritt zu begründen. Bevor wir auf den Pazifismus kommen, will ich wenigstens zwei scherenschnittartige Argumente geben. Scherenschnitt #1: Wenn man Fortschritt mit Hegel als vergrösserte Freiheit und Freiheit wiederum (scherenschnittartig) als „Anzahl der Möglichkeiten, sich zu verhalten“, nimmt, dann folgt unmittelbar, dass der Fortschritt erstrebenswert ist, weil in dieser einfachen Sicht jedweder Fortschritt niemandem etwas wegnehmen würde, sondern zu allem, was ist, nur weitere Möglichkeiten hinzu fügte. / Scherenschnitt #2 höbe (im Unterschied zu Hegel) auf die Lernfähigkeit der Menschheit ab. Fortschritt erschiene in dieser Ansicht weniger als vergrösserte Freiheit, sondern als kollektives Lernen. Das beträfe nicht nur technisches know-how, wiewohl die Menschheit in diesen Belangen besonders gelehrig ist. Es betrifft auch metaphysische Ansichten, beispielsweise über Götter, über die Reiche des Geistigen und des Materiellen, über Krankheit und Tod, über Glück und Lebenssinn. Die Menschheit lernt über solche Dinge hinzu; warum nicht auch über Kriege? Letztlich ist das Argument wieder dem der Freiheit sehr ähnlich: Wir mögen zwar vieles vergessen und verlernen, aber im Prinzip wissen wir beim Hinzulernen stets das Alte UND das Neue, so dass wir immer die Wahl haben, das Alte beizubehalten oder das Neue anzunehmen. Fortschritt besteht in dieser Sicht darin, dass wir nicht ewig am Alten kleben bleiben müssen, sondern in der Lage sind, uns etwas Neues zu erarbeiten UND gegebenenfalls auch das Neue zugunsten des Alten wieder zu verwerfen. Wieder wäre das — über längere Zeit — nur ein Zugewinn, ergo gut & erstrebenswert. / Soviel von möglichen (einfachen) Begründungen, warum Fortschritt in der Geschichte erstrebenswert ist. Einschubende.
Wenden wir endlich die Idee des zivilisatorischen Fortschritts auf die Frage der Gewalt, bzw. der Gewaltbefugnisse eines Staates, wird offenbar, dass der zivilisatorische Fortschritt in erster Linie die zivile Gewalt betrifft. Freiheit, mit anderen Worten, betrifft die Möglichkeiten, die ein Staat seinen Bürgern im Frieden einräumt. Dem Staat eignet in der Regel das wesentliche Gewaltmonopol und die Frage nach dem Fortschritt erscheint in dieser Hinsicht als Frage danach, wie groß dieses Gewaltmonopol tatsächlich ist und welchen Gebrauch ein Staat von ihm in Wirklichkeit macht.
Es leuchtet ein, dass solche Freiheit im Krieg erhebliche Einschränkung erfährt; und zwar durch beide Konfliktparteien. Die verteidigende Partei schränkt sie durch Kriegswirtschaft, Ausnahmezustand und vor allem Wehrpflicht ein, die angreifende durch schiere Gewalt, durch Bomben und Raketen, durch Töten und letztlich Zerstören jedweder Grundlage von Freiheit überhaupt. Deshalb kann Hegels Fortschritt den Kriegszustand nicht meinen (und meinte ihn auch nicht); deshalb auch nenne ich seine Idee von Geschichte die Idee des „zivilisatorischen Fortschritts“.
Die Kämpfe, die den zivilisatorischen Fortschritt voran bringen, sind jene um den Erlaß von Gesetzen oder deren Revidieren; Kämpfe um die Einrichtung oder Abschaffung von staatlichen Institutionen; Kämpfe um Deutungshoheiten und Interpretationsrahmen; Kämpfe um Werte und Rechte; Kämpfe um die Organisation von Bildung und Gesundheit; Kämpfe um Steuer- und Rentensätze; und natürlich Kämpfe um Steuerbudgets und Wähler — mit einem Wort, alles, was wir als innenpolitischen Normalbetrieb kennen. Diese Kämpfe sind das, wovon Hegel meint, dass sie der Wesenskern von Geschichte sind. Geschichte, historische Bewegung ist die Resultante jener Streits, der Argumente und Begründungsschemata, die in diesem Streit entwickelt werden und die Bewegung, die durch sie hervorgerufen wird; nicht aber von Kriegen zwischen Staaten. Das ist, was Hegels Geschichtsverständnis an die Stelle von Grenzverschiebungen, bzw. an die Stelle von Kriegen zwischen Staaten setzt.
Die imperiale Geschichtsauffassung, die ich dem einmal entgegensetzen will, ist jene, die auf Grenzverläufe und Herrschergeschlechter abzielt. Sie erscheint im Vergleich hohl, inhaltsleer und entmenscht. Einfach, weil in ihr Menschen nur insofern vorkommen, als sie Eroberer oder Verteidiger von Gebieten sind. Der wesentliche Inhalt imperialer Geschichtsbilder bezieht sich letzten Endes auf kontingente Grenzen und Grenzverläufe; was aber innerhalb dieser Grenzen sich abspielt, welche Zustände in ihnen herrschen und warum diese Zustände erhaltens- oder abschaffenswert sein sollten, darüber kann diese Geschichtsauffassung naturgemäss nichts sagen. Zentral kommen solche Auffassungen immer auf Gebiete und Gebietsansprüche, ohne eigentlich angeben zu können, wozu das Ganze.
Deswegen wird die imperiale Geschichtsauffassung oft um einen trüben Begriff von „Kultur“ ergänzt, der mit den territorialen Grenzen mitbezeichnet sein soll, aber in Wirklichkeit einfach ad hoc (zu Rechtfertigungsgründen) hinzu genommen wird. Was mit ihm gemeint sein soll und warum die jeweilige Kultur ihr spezifisches Gepräge hat und warum sie bestimmte (und nicht andere) Entwicklungen genommen hat, warum eine Kultur vielleicht schätzenswerter sei, als eine andere — zu all diesen Dingen kann das imperiale Geschichtsverständnis keine Auskunft geben. Sobald man nämlich dem Kulturbegriff einen halbwegs sinnvollen Gehalt geben möchte, muss man das Gebiet der Gebietsansprüche verlassen und sich in Hegels Nähe begeben; in Richtung Lebenssinn, Entfaltungsmöglichkeiten, Freiheit und eben „zivilisatorischer Fortschritt“.
Aus diesem Umstand werde ich mein Hauptargument verfertigen. Auf seine einfachste, vorläufige Botschaft gebracht, lautet es: Für die historischen Aufgaben, vor denen sich die Menschheit zu jedem Zeitpunkt findet, ist es im Wesentlichen egal, ob eine Grenze links oder rechts verläuft. Diese Aufgaben bleiben unverändert bestehen, weil sie nicht unmittelbar an Räumliches gebunden sind oder aus Räumlichem erwachsen. Der Krieg kann deswegen nichts zur Lösung der Menschheitsaufgaben beitragen. Selbst da nicht, wo er humanistisch begründbar scheint. Der Rest des Textes ist Auslegung und Verteidigung dieses Arguments.
Soweit, so einfach. Ich hoffe, dem Leser bis hier noch einmal vergegenwärtigt zu haben, warum die Idee des zivilisatorischen Fortschritts all das, was wir an uns selbst als „Geschichte“ im Sinne eines „nicht vollständig zufälligen Herkommens“ begreifen wollen, sehr viel fasslicher machen kann, als die Alternative einer imperialen Geschichtsauffassung. Kriege zwischen Staaten, soll das kapitelbeschliessend heissen, haben in der Regel weniger, als gerade zu glauben en vogue ist, mit der Geschichte zu schaffen; und auch nicht mit Gerechtigkeit oder der Durchsetzung zivilisatorischen Fortschritts.
(3) Kriegsrechtfertigungen sind nur diskussionswürdig, wenn sie universalistisch sind.
Hätten also die Erdbetrachter auf dem Mond gar nicht Unrecht? Können Kriege letztlich in der Tat nur das eine und sonst nichts: Territoriale Grenzen von Herrschaftsbereichen verschieben? Ist Pazifismus vielleicht eine Art, auf dem Mond zu leben und trotzdem recht zu haben? Oder zumindest einen bedenkenswerten Punkt?
Im Wesentlichen: Ja. (Es gibt Ausnahmen.) Aber: Ja.
Die eigentliche (und zu klärende) Kraft dieses Mondstandpunktes besteht in dem oben kursiv gesetzten „und sonst nichts“. Es impliziert, dass die Rechtfertigungen, die Kriegen normalerweise beigestellt werden — sie würden zB. eine überlegene Kultur exportieren oder eine Nation befreien etc. — in Wirklichkeit nicht stichhaltig sind.
Ich lege Wert darauf, dass ich nicht behaupte, Kriegsrechtfertigungen seien ausnahmslos Lügen (auch wenn es oft genug Lügen sind und waren). Ich anerkenne, dass Menschen in Kriege zogen, weil sie der Meinung waren, der Krieg könne all das Gute leisten, das er bezweckt, und wäre deswegen gerecht oder zumindest gerechtfertigt. Ich behaupte lediglich, dass diese Menschen sich hierin fast ausnahmslos irrten. Kriege haben all das nie geleistet und können es nicht leisten; und wenn es im Nachhinein so aussieht, als hätte ein Krieg derartiges geleistet, dann liegt praktisch immer eine Fehlinterpretation des Krieges vor.
Beginnen wir noch einmal davon, wie Kriege zwischen Staaten überhaupt gerechtfertigt werden, bzw. was mit ihnen offiziell erreicht werden sollte. Es wurde ja nicht immer behauptet, dass Kriege irgendeiner Befreiung dienten oder — allgemeiner — einen Beitrag zum zivilisatorischen Fortschritt leisten könnten.
Menschheitsgeschichtlich stelle ich mir vor, dass die frühesten Kriege — sagen wir: Überfälle zwischen ersten Seßhaften — überhaupt keine besondere Rechtfertigung erheischten. Der Mensch betritt ja die Arena der Evolution als ein territoriales Wesen; als Wesen, das sowohl Gebietsansprüche gegen seinesgleichen erhebt, als auch prinzipiell zur Aggression und zum Räuberischen fähig ist. Es zeichnet ihn von Anfang an aus, dass er derlei gemeinschaftlich tut und plant.
Am Anfang überfiel man einander vor allem aus Gründen des Raubes. In der Hauptsache raubte man vermutlich Land, Vorräte und Werkzeuge. Teils auch Menschen. Der Krieg musste das leisten: Er musste lohnenswerter sein, als selbst zu jagen oder anzubauen und er musste auch lohnenswerter sein, als die Opfer, Verluste und Toten, die seine Durchführung im Durchschnitt forderte. Ich schätze, er konnte das viele Jahrtausende leisten, sonst hätte er sich in der Geschichte weniger ereignet. Genauer: Er wäre sonst nach den unerbittlichen Regeln der Evolution als Überlebensstrategie schlichtweg ausgestorben.
Ist er bekanntermaßen nicht. Was indes ausstarb ist Raub als offizielles Kriegsziel und als Rechtfertigung von Kriegen. Ich deute dieses Aussterben des ursprünglich dem Menschen evolutionär mitgegebenen Kriegsgrundes als Beginn des Pazifismus. Seither schreitet dessen Siegeszug fort. Schreiten ist nur keine herausragend rasche Form der Fortbewegung. Der Pazifismus ist dazu verdammt, äußerst langsam begriffen zu werden. Es wird wohl auch daran liegen, dass es sich, seines Inhaltes wegen, verbietet, ihn seinen Gegnern einzutrimmen. Des unerachtet hat er schon ein erstaunliches Stück Wegs zurückgelegt.
Ich vermute, noch zu Zeiten Alexander des Großen war es nicht über die Maßen anstößig, zu verkünden, man würde jetzt mal losziehen, um z.B. das Reich der Perser zu erobern. „Erobern“, das Wort meinte, was es wörtlich bezeichnet, also „sich zum Obern aufwerfen“, die Bevölkerung der Region zu „unterwerfen“, mit anderen Worten, auf eine elaboriertere Form des ursprünglichen Raubzugs zu gehen. So war das noch vor zweieinhalbtausend Jahren.
Trotz der sittlichen Unbedenklichkeit solcher Raub- bzw. Eroberungszüge in der Antike wird vielleicht damals schon eine Rechtfertigung mitgeschwungen haben. Die Rechtfertigung jeder Herrschaft nämlich, dass sie zur Herrschaft natürlicherweise berechtigt sei. Dieser Gedanke vermengt Innenpolitisches mit Aussenpolitischem auf eine Weise, die bis heute wirkmächtig ist: Kaiser, König, Imperator, das waren allesamt innenpolitische Ämter, die der Herstellung eines zivilen Gemeinwesens dienten. Aber in ihnen wohnte stets die imperiale Tendenz, den Herrschaftsanspruch, den sie markieren, auch über die Grenzen des Reiches hinaus auszudehnen. Das war eine einfache Extrapolation des Amtes. Die Gründe, aus denen ein Kaiser oder König sich innenpolitisch zur Herrschaft berechtigt dünkte, statteten ihn (in seinem Selbstverständnis) auch mit dem Recht aus, bei Bedarf benachbarte Reiche zu überfallen und zu beherrschen.
Der Trugschluss, den Herrschaftsanspruch nach innen auch immer mal nach außen zu tragen, drang der Menschheit erst als Trugschluss zu Bewusstsein, als Könige und Kaiser aus der Mode kamen. Das in-den-Adern-führen blauen oder sonstanders gefärbten Blutes galt irgendwann nicht mehr als hinreichende Rechtfertigung für einen Herrschaftsanspruch. Daß sich Herrschaftsansprüche fortan nach innen legitimieren mussten, hatte auch profunde Auswirkungen auf die Aussenpolitik. Dieses Wechselspiel zwischen zivilisatorischem Fortschritt im Innenpolitischen und den sittlichen Vorstellungen, nach denen es gerechtfertigt sei (oder nicht), einen Krieg zu beginnen, will ich hier schon einmal der Aufmerksamkeit der Leserin vorstellen. Es hilft, zu verstehen, wo der zivilisatorische Fortschritt — auch der zwischen Staaten! — eigentlich herkommt. Aus dem Innenpolitischen. Praktisch immer daher.
In der Zwischenzeit meinte die „Natürlichkeit“ herrschaftlicher Verhältnisse allerdings recht Unterschiedliches. Am Anfang wird es wohl ein mehr oder minder schulterzuckendes „Wir sind einmal die Stärkeren“ gewesen sein, bzw. bald auch ein weniger schulterzuckendes, aber desto eindringlicheres „Die oder wir“. Was lag näher, als diese Über- bzw. Unterlegenheit im Kampf in eine prinzipielle Gruppen-Superiorität umzudeuten? Besonders, als der Glaube an Götter aufkam, konnte ein Sieg leicht als Begünstigung durch die Götter verstanden werden.
Wenn ein Sieg bereits Gottesgunst war, dann war eine Serie von Siegen die grundlegende Bevorzugung eines Volkes durch die Götter. Das kollektive Gedächtnis ist durchaus selektiv. Es entsinnt sich gern der Siege und verdrängt die Niederlagen. Eine Serie von Siegen ist auf diese Weise schnell als Kontinuum herkonstruiert und also auch die Gewolltheit von Volk und Krieg durch die Götter. So wurden Kriege post hoc durch die (gottgewollten) Siege sanktioniert. Diese post hoc-Form der Kriegsrechtfertigung nach dem Sieg ist bis heute üblich.
Aufkamen nach der Antike mindestens drei Formen der Kriegsrechtfertigung durch höhere Zwecke: (1) religiös motivierte Kriege; (2) völkisch motivierte Kriege; (3) humanitär motivierte Kriege. Das Heraufkommen des religiösen Grundes hatten wir gerade. Insgesamt nimmt die Geschichte der Kriegsrechtfertigungen den Bogen vom ehrlichsten aller Kriegsgründe: der unverhohlenen Raubabsicht, über stufenweise verbrämtere und abstraktere Konstruktionen: der religiösen und völkischen Rechtfertigung bis zu ihrer vorläufig höchsten Überfeinerung, dem Krieg nämlich aus Gründen der Menschlichkeit.
Offenbar wirkt etwas durch die Jahrtausende, das die Phantasie der Menschen, Rechtfertigungen für Kriege zu ersinnen, in immer luftigere Höhen getrieben hat. Einesteils halte ich (unironisch) dafür, dass dies der zivilisatorische Fortschritt ist. Ich empfinde als Fortschritt, dass im Verlauf der Jahrtausende immer höhere Ansprüche an die Rechtfertigungen gestellt wurden, die für das Führen eines Krieges angegeben werden mussten.
Andererseits darf uns das nicht in die Einbildung bringen, die Staaten seien heutzutage schon friedlicher und die Menschen schon zivilisierter und weniger roh, als vor zweitausend Jahren. Es sind nur sehr viel engere Verflechtungen zwischen den Staaten, den Ökonomien und den Menschen, die eine höhere Moral befördern. Politische und ökonomische Abhängigkeiten und Bündnisse, ergänzt durch instrumentell-technische Veränderungen, wie schnellerem Informationsfluss, Presse und Internet; und natürlich militärische Beweglichkeit, Reichweite und Vernichtungskraft erschweren es dem einzelnen Staat heute, einen Krieg zu beginnen. Er muss politische Sanktionen, wirtschaftliche Isolation und militärische Vergeltung befürchten. Ich habe, angelegentlich, nichts dagegen, dass Staaten aus solchen Gründen friedlicher werden. Im Gegenteil, wenn es der Fall ist, dass diese Entwicklungen das Führen von Kriegen erschweren und uns zu moralisch edler fühlenden Menschen machen, dann befürworte ich sie umstandslos.
Schliesslich auch folgt aus dem Gesagten, dass selbst der edelste und menschenfreundlichste Kriegsgrund nie den Verdacht von Schäbigkeit und Vorgeschobenheit loswerden kann. Allein der Fakt, dass es historisch eine Genese von schlechten zu besseren Kriegsgründen gibt, also von solchen, die wir heute nicht mehr akzeptieren, hin zu solchen, die uns im Mindesten debattierbar scheinen, erzeugt natürlich den Verdacht, dass es in Wirklichkeit nur darum geht, den immer gleichen Mist — den Krieg — mit lediglich neuen Argumenten zu verkaufen. Der Verdacht lautet, es habe sich nur das Argument verbessert, nicht aber der Krieg, bzw., was er in Wirklichkeit leistet und auch nur zu leisten in der Lage ist.
Tatsächlich glaube ich, dass das der Fall ist, wenn auch nicht bewusst. Jeder Krieg benötigte Menschen, die zutiefst von den Rechtfertigungen überzeugt waren, mit denen sie begründet wurden. Nicht nur die Rekrutierung von Kriegern erforderte dies; es ist auch eine notwendige Bedingung der inneren Verfasstheit von Kriegern. Den Krieg — auch fallweise — zu befürworten, heisst immer, in sich selbst ein grundlegendes moralisches Gebot zu übertönen, nämlich, dass man nicht töten solle. Deswegen auch gehen sachlichen Debatte über Kriegsrechtfertigungen so schwer zu führen; und ich vermute auch, dass dem Pazifismus genau deswegen oft eine derart groteske Wut entgegen schlägt. Menschen, die endlich geeignete Gründe gefunden haben, ihre innere Töthemmung zu übertönen, müssen auch nach aussen jede Stimme dieser Hemmung bereits im Ansatz niederbrüllen. Die Wut gegen den Pazifismus ist in der Regel ein sich-die-Ohren-zuhalten derer, die sich schon für den Krieg entschieden haben.
Zurück zu den Kriegszwecken: Unter die völkisch motivierten Kriege rechne ich auch die kolonialen Raubzüge, denn die Bewohner der kolonialisierten Ländereien wurden in der Regel als biologisch und/oder kulturell unterlegene „Völker“ dargestellt, woraus sich eine teils bis heute währende Arroganz der damaligen Usurpatoren speist (wir erinnern uns der post hoc-Sanktionierungen). Daraus folgt, dass ich auch die kulturelle Motivation von Kriegen nur als Spielart völkischer Rechtfertigungen begreife. Der Kulturbegriff substituiert das völkische Vokabular (besonders nachdem dessen Gebrauch in Verruf geraten ist) in den hier wesentlichen Belangen praktisch bedeutungsgleich. Vielleicht bezieht er sich weniger aufs kollektiv Biologische, als auf das kollektiv Erworbene und Erarbeitete. Am Ende folgern solche Rechtfertigungen aber allesamt ein Recht zur Herrschaft und zum Krieg aus der Tatsache, dass einige Menschen historisch anders geworden sind, als andere.
Den religiösen, genauso wie die völkisch-kulturellen Kriegsrechtfertigungen, eignet demnach ein einfaches gemeinsames Hauptmanko: Sie sind nicht universalistisch. Sie schließen von vornherein aus, dass ein anderes Volk (eine andere Kultur, ein anderer Gott) genauso zum Krieg berechtigt sein könnte wie das eigene. Zufällig ist es immer die eigene Kultur oder völkische Angehörigkeit oder die eigenen Götter, von denen sich ein Recht zum Krieg ableitet. Die anderen Götter und Kulturen seien zweitrangig und letztlich zur Unterwerfung vorgesehen; damit wären Kriege gerechtfertigt.
Ein ernst zu nehmendes Recht zum Krieg müsste natürlich zunächst einmal eine Gleichheit jedes Menschen und jeder Gruppe und jedes Staates vor diesem Recht voraussetzen; mit anderen Worten, es müsste universalistisch sein. Ein Recht, das nur für einige gilt, ist kein Recht, sondern ein Privileg. Es ist nun eine der Hauptrichtungen des zivilisatorischen Fortschritts gewesen, Privilegien abzuschaffen bzw. in universelle Rechte umzuwandeln; nichts anderes verlangt die emanzipatorische Grundvokabel „Gleichberechtigung“. Es kommt uns ungerecht und — mehr noch — unrechtfertigbar vor, unter den Staaten Sonderrechte zum Krieg zu verteilen. Das war nicht immer so; aber unterdessen hat sich diese Ansicht glücklicherweise durchgesetzt. Vielleicht nicht bei „America-first“-Leuten oder Islamisten, aber die sind ja bislang auch nicht als größere Theoretiker der Rechtfertigung ihres Superioritätsanspruches aufgetreten.
Mit anderen Worten, es ist ein historischer Fakt, dass die Auffassung davon, was ein Recht ist, Frucht eines zivilisatorischen Fortschritts ist, i.e. einer Reifung unseres Verständnisses davon, was ein Recht ist und wie es begründet werden müsse. In der Regel waren das innenpolitische Reifungs- und Erkenntnisprozesse. Der Universalismus ist in erster Linie eine Frucht der bürgerlichen Revolutionen, in denen die Idee der Gleichheit einer Jeden vor dem Recht Kontur gewann. Wie schon vorher die Idee des Königs (Kaisers, Imperators) „schwappt“ auch diese innenpolitische Idee ins Aussenpolitische über. Was unter Menschen gilt, das soll nun auch unter Staaten gelten.
Das ist kein Zufall. Bisher sind, sagt Hegel und sagen wir mit ihm, so gut wie alle wichtigen Anschauungen über das Schickliche, über Gerechtigkeit und über zu schaffende Institutionen etc. in innenpolitischen Auseinandersetzungen entstanden. Das liegt daran, dass das Innenpolitische einfach der Ort ist, an dem überhaupt nur ernsthaft diskutiert wird. Der Staat ist der Ort, an dem jedwedes Für und Wider Rahmen und Gehör finden. Die verschiedenen Parteien, die im Gesamt des Staates miteinander ringen, haben eben jenes Gesamt als ihre eigene Voraussetzung und Grenze. Sie müssen ihre Forderungen in der Regel so moderieren, dass ein halbwegs funktionables Gemeinwesen bestehen bleibt. Verwüstung, Zerstörung, Kompromisslosigkeit bis zum Tode — das sind Exzesse, die weder das Ziel einer Partei erreichen, noch überhaupt eine Debatte oder eine zivile Ideen- oder Kompromissfindung erlauben. Nicht so zwischen Staaten. Hier gibt es keine Klammer des Wohlverhaltens und kein erhaltenswertes Gesamt. Allgemein gesagt, wird es immer dann problematisch, wenn die Grenzen selbst zum Streitpunkt werden, die des Territoriums, wie die des zivilen Miteinanders.
Einschub, Illustration & Ergänzung: Hier ist eine gute Stelle, um zu erwähnen, dass ich keineswegs Urheber oder Erfinder des hier vorgetragenen und breitgewalzten Gedankens bin. Ich wende ihn nur auf die Frage des Pazifismus an. Vor mir hatten ihn bereits viele, zum Beispiel auch der Dichter (Hegelianer und Marxist) Peter Hacks. Er sagt in „Jona, Beiwerk und Hintersinn“ (März 1987, erschienen in „Sinn und Form“ 6-1988):
„Die Außenpolitik ist an der Politik das Geistlose. Wenn die Innenpolitik die Durchsetzung von Gedanken zwar gewiss nicht zum Ziel hat, so arbeiten doch die Klassen, wenn sie ihre Machtkämpfe betreiben, unbewußt und nebenher an einem Gesamtgefüge, dem Staat. So ein Staat hat eine Grenze; die ist der Rand bis zu dem man gehen kann, und der Rahmen, innerhalb dessen Fortschritte sich abstecken und messen lassen.
Die einzelne Klasse hat gelernt, ihr Bedürfnis mit dem der Gesellschaft zu vereinbaren. Indem sie um den Rang in der Gesellschaft streitet, erkennt sie sie an. Indem sie sich bemüht, das Ganze nach ihren Vorstellungen zu gestalten, bemüht sich sich um das Ganze. Sie hält den Kampfort sauber, der auch ihr Wohnort ist. Für den einzelnen Staat gilt das alles nicht. Es gibt keine Staatengesellschaft. Für eine bessere Gesellschaft geht zu kämpfen, nicht für eine bessere Welt.
Wie verschieden Staaten in ihrer Gesittung irgend sein mögen — unter sich sind sie einfach gleich. Ihrer innern Bildung nach sind sie mehr oder minder menschenähnlich. Nach außen sind sie immer noch wie die Höhlenleute, ich will sagen, wie die unerzogenen unter denen. Oder wie Hegel sagt: „im Naturzustande gegeneinander“.
Daher steht die Außenpolitik mit den jeweiligen Innenpolitiken kaum in genauem, gelegentlich in umwegigem und gemeinhin in gar keinem Zusammenhang. (…)
Ich halte nichts davon, Übel für ewig anzusehen, nur weil sie von jeher sind. Ich bin ganz sicher, dass die Molekularbiologie die meisten Krankheiten abstellen wird und die Atomphysik den Energiemangel. Bis dahin werden wir noch an Krebs sterben und unter schmutzigen Bäumen wandeln. Ich verlange von keinem, dass er sich mit Außenpolitik wohlfühlt. Aber mit der bestimmteren Vorstellung vom Ende der Außenpolitik besitzen wir überhaupt erst einmal ein Denkwerkzeug, das uns befähigt, gute Außenpolitik von schlechter Außenpolitik zu unterscheiden. Gute Außenpolitik, das ist Außenpolitik zur Abschaffung von Außenpolitik. Das Ende der Außenpolitik wäre der Anfang der Geschichte.“
Natürlich bezeichnet „Ende der Außenpolitik“ den Mond- bzw. Menschheitsstandpunkt; und mit dem den Universalismus. Wir hatten schon, dass der Universalismus seinerseits eine Errungenschaft des zivilisatorischen Fortschrittes ist. Warum war er ein Fortschritt zB. gegen feudale Privilegien? Nun, zum einen entspricht er unserem modernen Verständnis von Gerechtigkeit. Dass ein Recht für jeden Menschen, wie auch für jeden Staat gleichermassen gelten soll, erscheint uns intuitiv richtig. Man kann natürlich weiter gehen und fragen, warum uns diese Gleichheit gerecht vorkommt? Die Frage nach einer fundamentalen Begründung des Universalismus wird mindestens seit Kant diskutiert; aber ich glaube gar nicht, dass er eine wasserdichte Begründung unbedingt benötigt. Es reichen meiner Meinung einige Hinweise. Den Rest muss, wie alles in der Geschichte, die Geschichte selbst empirisch erweisen. Ich halte Recht, Gerechtigkeit und Moral grundsätzlich für geronnene und reflektierte kollektive Erfahrung (im Ggs. zu „aus ersten Prinzipien herleitbar“). Rechtsauffassungen haben sich in der Geschichte durch ihre Bewährung durchgesetzt (oder nicht); und so wird sich auch der Universalismus dem Tribunal seiner Auslegungen und praktischen Anwendung stellen müssen. Zu den philosophischen Vernunftshinweisen, die ihn zu begünstigen scheinen, gehört, dass er zum Einen einen gewissen Schutz vor Willkür und Leid verspricht und zum Anderen, dass er jeden Menschen (bzw. jeden Staat) zumindest hinsichtlich der Berechtigung seiner Ziele gleichermaßen ermutigt und teils auch befähigt.
Das soll erstmal an Gründen genügen, um die Debatte im Folgenden wieder auf das einzuengen, womit wir (intuitiv, aber weniger begründet) gestartet sind: Auf humanitäre Kriegsrechtfertigungen. Raub, völkische und religiöse Kriegsrechtfertigungen sind raus. Und wir können jetzt mit einem Wort sagen, warum: Sie sind nicht universalistisch.
Falls dem Leser angelegentlich die Frage einkommt, welches der Unterschied zwischen einem universalistischen Rechtsanspruch und Kants kategorischen Imperativ sein soll: M.E. läuft es darauf hinaus, dass der universalistische Rechtsanspruch nur eine prinzipielle Eignung zu einem allgemeinen Gesetz markiert. Der Universalismus rechtfertigt im Gegensatz zum kategorischen Imperativ keinen Anspruch auf Gültigkeit. Stattdessen erachte ich, dass ein universalistischer Rechtsanspruch lediglich einen Anspruch auf Diskussionswürdigkeit der ihn anleitenden Prinzipien hat, bzw. eine wichtige Voraussetzung für seine Diskussionswürdigkeit ist.
Eins noch zu Raub, völkischen und religiösen Kriegsrechtfertigungen: Es soll nicht übergangen sein, dass diese Kriegsrechtfertigungen auch in einer schein-universalistische Spielart vorkommen. Sie lautet ungefähr, dass alle Völker/Kulturen bzw. Götter in stetem Kampf miteinander liegen würden und also alle Kulturen/Religionen gleichermaßen berechtigt seien, andere zu überfallen. Ich sage „schein-universalistisch“, weil in einer solchen Welt der Krieg offenbar zum Normalzustand erklärt wird, also in Wirklichkeit gar keiner Rechtfertigung mehr bedarf. Das Wort vom „Recht“ (zum Krieg) fügte in diesem Fall der Beschreibung des Normalzustandes nichts hinzu; es herrschte dann eben ein ewiger Krieg, Punkt. — Es verhält sich nur eben so, dass diese Auffassung empirisch falsch ist. Kein Staat der Welt beginnt heute einfach einen Krieg ohne Rechtfertigung. Es schickt sich nicht und es motivierte auch niemanden, mehr oder minder begründungslos in den Krieg zu ziehen. Irgendeine Story ist immer benötigt, sowohl zur aussenpolitischen Rechtfertigung, als auch innenpolitisch, um Soldaten zu Soldaten zu machen. Sofern entlarvt sich die Rede vom angeblichen ewigen Krieg als genau das, was sie überflüssig zu machen vorgibt: Als Kriegsrechtfertigung nämlich.
Bleibt endlich also der humanitäre Grund: Kriege, die der Befreiung dienen sollen, Kriege zum Beenden unmenschlicher Zustände; Kriege, allgemeiner, die der Minderung von menschlichem Leid dienen sollen. Beginnen wir mit dem einleuchtendsten und verbreitetsten unter denen, dem Verteidigungskrieg.
Ist der Verteidigungsfall ein Sonderfall unter den Kriegsrechtfertigungen? Sind Verteidigungskriege generell und ausnahmslos gerechtfertigt? Dies ist ein anhaltender Streit unter Pazifistinnen. Wiewohl ich keine genaue Zahlen kenne, vermute ich, dass die Mehrzahl der zeitgenössischen Pazifistinnen in der Regel dafür hält; ein Staat hat in deren Sicht die generelle Befugnis, sich zu verteidigen. Es mag sein, dass sich solche Berechtigung aus handlungsethischen Betrachtungen folgern läßt. Aus der geschichtsphilosophischen Einordnung, die ich hier vornehme, läßt sie sich nicht generell ableiten; und ich bin folglich auch nicht dieser Meinung.
Aus den hier eingenommenen Gesichtspunkt folgt zum Beispiel, dass ein Verteidigungskrieg, der ein brutales, menschenverachtendes Regime durch militärische Verteidigung am Leben hielte, schwer zu rechtfertigen wäre. Auch aus handlungsethischer Sicht wäre ein Verteidigungskrieg, der unmäßige Opfer fordert und ohne realistische Aussicht auf Frieden oder Sieg ist, nicht rechtfertigbar. Es ist in jedem Fall vorstellbar, dass es Verteidigungskriege geben kann, die sowohl hinsichtlich des erzeugten Leids sinnlos (weil zB. nicht gewinnbar) sind, und/oder unfähig, zivilisatorischen Fortschritt zu bewirken, weil sie eine ungerechte Staatsordnung verteidigen und erhalten. Ich behaupte nicht, dass solche Argumente in jedem Fall stichhaltig sind, aber sie sind geeignet, eine ungeprüfte und umfassende Absolution des Verteidigungsfalles fragwürdig zu machen.
Andersherum kann es durchaus sein, dass ich einen Verteidigungskrieg als rechtfertigbar ansehe; insbesondere, wenn er mit vergleichsweise kleinem Leid den Schutz bzw. die Wiederherstellung eines gut funktionierenden zivilen Friedens leisten kann. Aus solchen Gründen lehne ich es aber ab, den Verteidigungsfall als prinzipiell rechtfertigungsprivilegiert anzusehen. Jeder Krieg bedarf einer gesonderten Prüfung; ein Pazifist hat nur eben den Grundsatz in dubio contra bello. Und er neigt zum Zweifel.
Im Verteidigungsfall schlage ich also vor, die Verteidigung einfach als Unterart der humanitären Rechtfertigung einzuordnen. Dadurch wäre auch abgedeckt, dass Angriffskriege notorisch zu ihre Rechtfertigung als Verteidigung ausgegeben wurden, nichtzuletzt der statthabende Überfall Russlands auf die Ukraine (man wehre sich vereitelnd gegen die NATO, bzw. „den Westen“; man schütze/befreie die in der Ukraine unterdrückte Minderheit der Russen etc.). Sogar der zweite Weltkrieg hub mit dem eigens fingierten Überfall auf den Sender Gliwice an; die Deutschen, so Hitler zu Kriegsbeginn, würden lediglich „zurück schießen“. Nichtmal Hitler traute sich, loszuschlagen, ohne seinen Angriff zur Verteidigung umzulügen.
Das umständlich erreichte Fazit dieses Kapitels lautet nun, dass von allen Kriegsrechtfertigungen nur der humanistische Grund einen Anspruch auf Diskussionswürdigkeit hat und der Verteidigungsfall nur ein Spezialfall hiervon ist. Und meine These besteht darin, dass die humanistischen Verbesserungen, die zu erreichen der humanistische Krieg ein zweckrationales Mittel zu sein beansprucht, in Wirklichkeit fast ausschliesslich durch den zivilisatorischen Fortschritt, d.h. durch innenpolitische Kämpfe, erzielt werden. Der Krieg kann sein humanistisches Versprechen nicht einlösen. Nicht allein, weil er Leid und Schmerz verursacht, sondern, weil es fundamental nicht in seinen Fähigkeiten und Zuständigkeiten liegt. Er schafft auch nicht die Vorraussetzungen für zivilisatorischen Fortschritt; und er schafft auch die Voraussetzungen nicht für den zivilen Frieden.
Gleichzeitig haben wir gesehen, dass dieses Fazit selbst das Ergebnis eines zivilisatorischen Fortschrittes ist. Auch wenn die Menschheit in der Regel nach großen Kriegsunternehmungen erschöpft und von sich selbst angewidert war, lernte sie doch wenig aus solchen Episoden. Das Lernen fand statt, indem die Menschheit die Bedingungen, unter denen sie arbeitete, lebte, handelte und stritt, veränderte. Solches ging einher mit der Veränderung von Auffassungen über Recht, Sittlichkeit, staatliche Institutionen und so fort. Die humanitäre Kriegsrechtfertigung kommt zum größten Teil aus diesen Lernprozessen; wie auch die Entwicklung des Pazifismus.
(4) Grenzwertiges, erster Teil. Grenzverschiebungen.
Wieso dürfen die territorialen Grenzen eines Staates nicht nach Laune verschoben werden? Wie hängen die territorialen Grenzen eines Staates mit dem zivilisatorischen Fortschritt zusammen? Gibt es überhaupt einen derartigen Zusammenhang?
Das sind ungewohnte, wo nicht unverschämte Fragen. Jeder Staat und sogar Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen besteht auf „territoriale Unversehrtheit“. Das Territorium scheint fast genauso heilig wie die „Würde des Menschen“. — Warum eigentlich? Was ist so schlimm daran, wenn ein Staatsgebiet von einem anderen Staat appropriiert wird; oder wenn ein Territorium sich von einem bestehenden Staat abspaltet?
Ist nicht jede Staatsgrenze willkürlich und durch irgendeine zurückliegende (forcierte?) Einigung, Eroberung oder Abspaltung entstanden? Diese gewalttätige Vergangenheit soll nach der UN Charta nicht als falsch und korrekturbedürftig gelten. Aber was wäre heute anders, als damals; warum sollte der (zufällig so gewordene und auf vergangener Gewalt basierende) derzeitige Stand der Grenzverläufe einen besonderen Schutz geniessen?
Recht eigentlich doch nur (wie ich sogleich nahelegen werde), weil es bei Verletzung der Grenzverläufe zum Krieg käme. Der (grenzverletzende) Krieg soll, mit anderen Worten, nicht begonnen werden, weil es sonst zum Krieg käme. Es sieht ganz danach aus, als würde hier ein Verbot (i.e. Negation eines Sollsatzes) mit sich selbst begründet. Das ist zwar ein schwaches Argument, aber immerhin lebenspraktisch und nachvollziehbar.
Warum es ein schwaches Argument ist: Alle Soll-Sätze kranken bekanntermassen daran, dass sie ihrerseits nur mit Soll-Sätzen begründbar scheinen. Es ist also keine besondere Schwäche pazifistischer oder pazifismus-feindlicher Forderungen; kein Pazifist käme auf die abwegige Idee, die Sinnhaftigkeit von Sollsätzen aus diesem Umstand zu bestreiten. Man soll einfach keine Kriege führen. Punkt. Das lässt sich letztlich genauso gut oder schlecht begründen, wie das Gebot Nummer fünf, man solle nicht töten. Es ist einfach schwer, eine ethische Maxime ausserhalb ethischer Argumentationsschemata zu befestigen und stark zu machen. Deswegen auch dieser Aufsatz, deswegen meine Bestrebung, andere als ethische Gründe für das Nichtführen von Kriegen zu ersinnen.
Dies in Kürze von schwachen Begründungen für Soll-Sätze. Das für unsere Belange Bemerkenswerte geschieht aber erst, wenn wir versuchen, irgendeine andere der gängigen Begründungen für das Verbot willkürlicher territorialer Grenzverschiebungen untersuchen. Es wird erstaunlich schwierig. Probieren wir es aus!
Beginnen wir mit einem Beispiel, das Menschen spontan einzufallen scheint, wenn sie danach gefragt werden, was so schlimm an der Vorstellung sei, dass sie morgen aufwachen und plötzlich zu einem der Nachbarstaaten gehören würden: Die Sprache. Die Vorstellung scheinen viele Menschen besonders zu abhorrieren, plötzlich eine andere Sprache sprechen zu müssen. „Ich möchte deutsch sprechen und nicht polnisch!“, heisst es dann etwa. Oder „Meine Kinder sollen deutsch in der Schule lernen!“ Derlei.
Ich will gar nicht darauf hinaus, dass Sprachen genauso kontingent wie territoriale Grenzen sind; und dass natürlich die meisten Sprachen längst ausgestorben sind (und es vermutlich das unvermeidliche Schicksal jeder Sprache ist, eines Tages ausgestorben zu sein; vielleicht auch jeder Grenze?).
Gewiss, es ist ein grosser Zufall, dass wir in Deutschland deutsch sprechen, womit ich meine, dass deutsch den Wortschatz, die Grammatik und den Klang hat, den es einmal hat; und es ist auch klar, dass das Deutsch, das wir heute sprechen, von dem Deutsch vor tausend Jahren so weit entfernt ist, dass wir uns mit den Bewohnern jener Zeit so gut wir gar nicht unterhalten könnten (und also überhaupt erstmal gesagt werden müsste, wiefern es es sich noch um die selbe Sprache handelt). — All das mag richtig sein, aber es ist kein Argument dagegen, dass Menschen diese Sprache nun einmal sprechen möchten; egal, ob deutsch sich vor anderen Sprachen objektiv und auf irgendeine signifikante Weise auszeichnen lässt oder nicht. Menschen essen auch gern Vanillepudding und ich sehe keinen Grund, diese Vorliebe nicht ernst zu nehmen, nur weil es andere Speisen gibt, gab und geben wird, die anderen Menschen munden (mundeten, munden werden).
Was ich indes entgegnen würde, ist dies: Die Frage, ob wir in diesem Land deutsch sprechen, ist eine innenpolitische Entscheidung. Es war immer eine innenpolitische Entscheidung und es wird auch künftig eine innenpolitische Entscheidung bleiben. Sie hat wenig bis gar nichts damit zu tun, ob zB. das Saarland (oder Elsaß-Lothringen) zu Deutschland oder Frankreich gehört, sondern mit den Rechten, die die Bewohner dieses Landstriches für sich erstreiten oder erstritten haben. „Deutsch“ ist zB. nie eine einheitliche Sprache gewesen; aber durch verschiedene Gesetze und Regeln wurde es im Gebiet des „Heiligen römischen Reiches deutscher Nation“ und später des „Deutschen Reiches“ zu einer gewissen (nie kompletten) Einheitlichkeit harmonisiert. Ein politisch herbei geführter Prozess. Die Sprachen von Minderheiten (zB. der Sorben oder der dänischen Minderheit im Norden Deutschlands) geniessen seit dem zweiten Weltkrieg einen gewissen Schutz und werden regional in den Schulen gelehrt. Allerdings erscheint dieser Schutz sehr willkürlich und hat zB. wenig mit der Anzahl der Sprecher einer Sprache zu tun (es gibt in Deutschland erheblich mehr türkischsprachige Menschen, als sorbischsprachige; ca. 1,5Mio vs. 60.000). Womit ich nur empirisch belegen will: Das offizielle Sprechendürfen von Sprachen ist eine Frage des Verständnisses von Rechten, des Verständnisses davon, wie sehr Mehrsprachigkeit die Verwaltungs- und sonstigen Abläufe eines Staates hindert oder fördert und so fort. In der vielsprachigen Schweiz beispielsweise würde man über das Argument, man hätte bei Eroberung Angst um seine Sprache vermutlich lachen (den Fall angenommen, man trifft einen lachbereiten Schweizer).
Hinzu kommt, dass auch die Faktenlage der Geschichte belegt, dass der Ausgang von Kriegen keineswegs immer bedeutet hat, dass den danach andersbeherrschten Ländereien eine neue Landessprache oktroyiert wurde: Die Römer haben den von ihnen eroberten Reichen ihre lokalen Sprachen in der Regel gelassen. Ich selbst bin in der DDR aufgewachsen, einem Teil Deutschlands, das sich mit einigem Fug als sowjetisch erobertes Gebiet auffassen lässt. Bekanntlich wurde in der DDR deutsch gesprochen und ich empfinde es nicht als ehr- oder kulturabschneidend, dass wir in der Schule Russisch als Fremdsprache erlernten. Die Wahrheit ist, ich fühle mich dadurch bereichert. Ähnlich verhält sich der derzeitige Kultur- und Militär-Hegemon USA: Weder haben die USA in den von ihnen kontrollierten oder besetzten Gebieten (zB. Japan nach dem zweiten Weltkrieg) englisch als Landessprache eingeführt, noch die ursprüngliche Landessprache verboten. Es geschieht einfach nicht automatisch, dass eine Sprache im Fall einer Eroberung verboten wird; und wenn es solche Versuche gibt, dann ist es in der Regel eine Frage innenpolitischer Kämpfe und Hartnäckigkeit, das Recht auf offizielles Sprechendürfen dieser Sprache zu erstreiten.
Was wir am Beispiel der Sprache durchexerziert haben, ist an der Regel. Das war der Sinn dieses Exerzitiums. Praktisch alle Rechte und Einrichtungen, von denen Menschen sagen, sie würden Wert auf ihren Erhalt oder ihre Einrichtung legen, wurden in innenpolitischen Kämpfen erstritten oder müssen künftig in solchen erstritten oder (leider auch manchmal) wieder-erstritten werden. — Mit Ausnahme lediglich der territorialen Grenzen und vielleicht einiger im Krieg akut benötigter militärischer Institutionen.
Wir können das gern weiter illustrieren. Wie verhält es sich zum Beispiel mit fundamentalen demokratischen Rechten (zB. Reisefreiheit, Recht auf freie Meinungsäusserung etc.)? Ist es nicht so, dass beispielsweise gravierende Unterschiede zwischen den Staaten hinsichtlich ihrer freiheitlich-demokratischen Verfasstheit bestehen? Wären nicht also Ängste berechtigt, dass demokratische Rechte in einem eroberten Staate zum Teufel gehen könnten?
Ist nicht zB. eine unzureichende Trennung von Legislative und Judikative in der DDR eine Folge der Eroberung durch die Sowjetunion (in der diese Trennung ebenfalls nach heutigem Rechtsverständnis nicht hinreichend vollzogen war); und wäre die DDR also in dieser Hinsicht nicht ein Rückschritt hinter die Weimarer Republik gewesen? Auch der unbedingte und alleinige Führungsanspruch der kommunistischen Partei scheint ein Rückschritt hinter die Parteiendemokratie Weimars, etc. Ich lasse an dieser Stelle unbesprochen, dass die DDR in anderen Hinsichten ein Fortschritt gegenüber Weimar war, weil uns hier allein die Frage interessiert, ob nicht die territoriale Neuaufteilung durch einen Krieg den zivilisatorischen Fortschritt zunichte machen könne? Und wenn er ihn zunichte machen, d.h. zurück bewegen kann, dann kann er ihn ganz prinzipiell bewegen, was ein Argument gegen meine Auffassung zu scheint, der Krieg habe ganz allgemein nicht viel mit dem zivilisatorischen Fortschritt zu schaffen.
Nein, wieder hat der Krieg gar nichts bewegt. Tatsächlich verhält es sich ganz genauso, wie beim Beispiel der Sprache. Der Einwand übersieht, dass die zivilisatorischen Unterschiede zwischen den Staaten bereits vor Ausbruch von Kriegen bestehen und nicht durch den Krieg selbst erzeugt werden (wie auch Unterschiede der Sprache vorher bestanden). Jede staatliche Institution, jedes Recht, oder Unrecht, das durch Eroberer von einem Ort an einen anderen gebracht wird, ist seinerseits durch innenpolitische Kämpfe (im Reich der Eroberer) zustande gekommen. Im obigen Fall war es die russische Oktoberrevolution und deren Folgen, die das sowjetische Einparteiensystem hervor gebracht hatten, welches nun in Folge des Überfalls der Sowjetunion durch Hitlerdeutschland mit anfolgender Niederlage der Deutschen in die gegeneroberten Gebiete exportiert (und dort leicht modifiziert) wurde. Der Krieg fungiert niemals als jener Prozess, der den zivilen Fortschritt oder Rückschritt erschafft; er transportiert ihn lediglich in neue Gebiete. Das, was er transportiert, kann er selbst nicht erzeugen.
Wenn wir schon dabei sind: Der eigentliche zivilisatorische Rückschritt in Deutschland war natürlich der (im Wesentlichen demokratisch erfolgte) Wahlsieg der NSDAP im Januar 1933; er ermöglichte die Errichtung des nationalsozialistischen Terrorstaates, die Shoa, den zweiten Weltkrieg und, wie schon gesagt, in dessen Konsequenz die Eroberung der Ostgebiete Deutschlands durch die Sowjetunion, bzw. die Spaltung Deutschlands in die DDR und die BRD.
Es geht mir bei diesem Gang der Ereignisse nicht um Schuldfragen. Es geht mir zentral darum, den scheinbaren Unterschied zwischen einem zivilisatorischem Rückschritt, der durch einen Krieg von aussen importiert wird und einem Rückschritt, der das Resultat innenpolitischer Kämpfe ist, fragwürdig zu machen. Wir sind sehr geneigt, diesen Unterschied zu übertreiben. Ein ausländischer Feind darf mit Raketen und Bomben bekämpft werden, ein inländischer Feind hingegen nur nach den Regeln des Zivilgesetzbuches.
Das halte ich für einen folgenschweren Denkfehler. Er bewirkt, dass wir Kriege sowohl stärker dämonisieren, als nötig (die Einfallenden würden allerhand Barbarei in die eroberten Ländereien bringen); als auch übertrieben glorifizieren und mit Fähigkeiten ausstatten, die Kriege tatsächlich gar nicht haben (Freiheit bringen, Rechte erstreiten etc.). In Wirklichkeit verhält es sich so, dass der Dämon und die Barbarei der Krieg selbst ist; und der Fortschritt- oder Rückschrittbringer die innenpolitischen Auseinandersetzungen innerhalb der Staaten.
Natürlich drängt sich der Einwand auf, dass es sehr wohl einen Unterschied machte, ob Rückschritt und Willkür von aussen kommen oder (selbsterwählt) von innen. Es sei ungefähr der Unterschied zwischen „selber Stolpern“ und „ein Bein gestellt bekommen“. — Gewiss gibt es in Hinsicht der Verursachung und also auch in Fragen der Schuld einen Unterschied. Den will ich nicht bestreiten. Bestreiten will ich lediglich einen Unterschied in Hinsicht auf das kaputte Knie. Die Knieverletzung nach dem Hinfallen ist ganz dieselbe. Das Knie wird unerachtet des Herganges und der Verschuldung seiner Verwundung auf ein und die selbe Weise heilen müssen. Genauso verhält es sich mit den demokratischen Rechten. Sie können nur in innenpolitischen Kämpfen errungen werden. Ausschliesslich so.
(5) Der größte Eroberungszug der Geschichte: Ein Gedankenexperiment
Wir wollen das, wennmöglich, noch deutlicher. Die Vorstellung, dass es einen entscheidenden Unterschied macht, ob ein zivilisatorischer Rückschritt von aussen (zB. durch Eroberung) oder von innen (zB. durch Machtergreifung eines Tyrannen) verursacht wird, scheint mir eigentlich noch fragwürdiger, als oben bereits zu erkennen gegeben. Menschen, die den Unterschied von aussen vs. innen für wesentlich halten, glauben offenbar an eine Art innerstaatlichen Zusammenhalt auch mit Kräften, von denen sie ansonsten glauben, dass sie einen zivilisatorischen Rückschritt erreichen wollen. Der deutsche Faschist ist in dieser Sicht tolerabler, als der russische Imperialist. Wenn fragwürdig scheint, den inländischen Faschisten mit Mordwaffen zu bekämpfen — auch wenn der selbst brandschatzt und mordet — erscheint da nicht genauso wenig rechtfertigbar, den ausländischen Feind mit Raketen und Bomben zu bekämpfen?
Diese Frage wird besonders rätselhaft, wenn man von dem Gedanken ausgeht, dass selbst, wenn einfallende ausländische Horden einen zivilisatorischen Rückschritt mitbringen, deren mitgebrachter zivilisatorischer Stand ja seinerseits Resultat der innenpolitischen Lage im Gemeinwesen jener Horden ist. Mit anderen Worten, dass lediglich innenpolitische Unterschiede im Aussenpolitischen aufeinander treffen.
Ich möchte, um das deutlicher zu machen, ein sehr simples pazifistisches Gedankenexperiment veranstalten. Nehmen wir einmal an, ein Land überfiele sein Nachbarland und jenes führte keinen Verteidigungskrieg, sondern ergäbe sich in pazifistischer Weisheit brav und widerstandslos. Der Aggressor sieht sich durch diese leichte Eroberung ermutigt und überfällt auch das nächste Nachbarland (so wird ja immer vor der Unersättlichkeit von Imperialisten gewarnt; man dürfe deren Landhunger gar nicht erst ermutigen). Zur Überraschung der Usurpatoren werden auch im Nachbarland pazifistische Ansichten gepflogen und auch jenes fällt sonder Mühe unter die Knute der Eroberer. Also fahren sie fort, Land für Land zu erobern. Überall das Gleiche. Bürger, Städte, Wälder, Eilande und Gewässer fallen unter die Macht der Eroberer. Am Ende wären praktisch alle Länder der Erde durch die ursprünglichen Usurpatoren bezwungen und beherrscht. Und nennen wir die neuen Weltherrscher einmal die Usurpater.
Für unser Gedankenexperiment ist nicht erheblich, ob im Resultat restlos alle Länder erobert wurden, oder nur sehr viele; nehmen wir der Einfachheit halber an, es seien alle. Ein ähnlicher Zustand war vielleicht im römischen Reich zu Zeiten seiner größten Ausdehnung erreicht; soweit ich sich nachschlagen lässt, befanden sich damals etwa dreissig bis fünfunddreissig Prozent der gesamten Weltbevölkerung unter Roms Herrschaft. Das entspräche in der heutigen Zeit einem Reich mit etwa 2.7 Milliarden Bewohnern.
Und das ist schon fast das ganze Gedankenexperiment. Sehr unspektakulär und wenig originell auf den ersten Blick. Ich finde gerade seine Einfachheit so überzeugend: Denn das Gedankenexperiment des ultimativen Eroberungszuges hat mit einem Schlag die gesamte Weltpolitik in Innenpolitik verwandelt. Man übersieht an seiner Hand, dass keine Frage des zivilen Fortschritts, keine des zivilen Friedens, kurz: keine Frage der Geschichte durch den ultimativen Eroberungszug wirklich berührt wurde. Alle wichtigen zivilen und emanzipatorischen Probleme fahren fort zu bestehen; es verschwinden nur die aussenpolitischen Händel, Eifersüchte und Konkurrenzen. Teilweise werden sie in innenpolitische Probleme verwandelt; teilweise verschwänden sie ganz und gar. Natürlich entstehen auch neue, vermutlich sogar enorme Probleme. Auf die komme ich sogleich. Aber: Es wären auch die neuen Probleme innenpolitische Probleme.
Nichts anderes als Hacksens „Abschaffung von Außenpolitik“ betreibt unser Gedankenexperiment einmal konkret. Natürlich stünde ein in der Folge enstehender hypothetischer Allvölkerstaat vor gewaltigen politischen und verwalterischen Aufgaben. Vor unbewältigbaren, genauer zu sein. Darauf komme ich sogleich. Der entscheidende Punkt bleibt wieder einmal, dass alles, was wirklich von Belang für die Menschen zu sein scheint, jederzeit durch so ein Gedankenexperiment in innenpolitische Aufgaben umgewandelt werden kann. Kriege haben reinweg gar nichts mit solchen Sachen zu schaffen. Wie gesagt, ständig wird gewähnt, gewünscht und behauptet, dass Kriege viel mehr vermöchten: Freiheit bringen, Völker emanzipieren, die Gesittung heben. Nein. Können sie nicht. Dazu bedarf es immer und wesentlich anderer Tätigkeit, als der des Kriegführens. Darum geht es mir; ich finde in dieser Einsicht liegt eine starke Rechtfertigung des Pazifismus. Der Pazifismus ist nicht nur eine Position, die versucht, die angebliche fallweise Notwendigkeit von Leid und Schrecken mit rationalen Argumenten zu widerlegen. Er trachtet auch, der Menschen Auge fürs Wesentliche schärfen; dafür, dass Kriege ihnen nicht das bringen können, wonach sie sich sehnen. Nicht Gerechtigkeit, nicht Fortschritt, nicht Freiheit und mit ziemlicher Sicherheit keinen Frieden. Diese sogenannte „Dialektik“ des Krieges („Si vis pacem para bellum“) entblättert sich auch aus dieser Sicht zu der hohlen Phrase, die sie schon immer war.
Natürlich gibt es Einwände. Der Haupteinwand wird wieder lauten, dass doch aber nach dem ultimativen Eroberungszug alle Menschen (mit Ausnahme der Usurpater) unterdrückt wären und der Krieg einen zivilisatorischen Rückschritt bewirkt hätte. Man könnte dieses Argument sogar noch forcierter bringen, indem man behauptet, dass es nach dem ultimativen Eroberungszug überhaupt keinen zivilen Frieden mehr gäbe, sondern nur noch einen prolongierten, vielleicht mit Polizei anstatt Armee geführten Kriegszustand. — Ich würde entgegnen: Von ersterem lässt sich zeigen, dass es kein Gegenargument ist (tue ich gleich); und zweiteres ist reine Rabulistik, eine Vermischung der Kategorien. Es gibt einen Unterschied zwischen Armee und Polizei; und einen zwischen Krieg und Aufruhr; und das falsche Verwenden der Begriffe geschieht wahrscheinlich mit dem bewussten oder unbewussten Ziel, bewaffneten Widerstand zu legitimieren.
Ja, auch das Unbewusste spielt eine Rolle. Der Krieg ist ja nicht nur Resultat rationaler Entscheidungen und politischer Willensfindung, sondern auch einer bestimmten psychologischen Verfasstheit. Krieger drängt es zum Krieg. Der Vorgang des zum-Kriege-drängens ist mir selbst gänzlich fremd, weswegen ich über sein Zustandekommen und sich-Anfühlen nur mutmassen kann. Ich glaube, der psychologische Drang zum Krieg ähnelt sehr dem Beißreflex eines Hundes, wenn er „sein“ Territorium verletzt sieht. Er stürzt sich umstandslos auf den Eindringling, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, warum er das tut. Es ist ihm eingeboren, er ist ein Hofhund. Geradeso der Krieger. Er sieht das Eindringen und spürt den unmittelbaren, enorm intensiven Drang, zu bestrafen und der gesehenen Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Post hoc erst rationalisiert und begründet er und erklärt den Krieg für vernünftig. Das Abrufen und Einsetzen dieser Reflexe geschieht derart schnell und gründlich, dass ich mir keine andere Erklärung weiss, als dass es Reflexe sein müssen. Als der Ukrainekrieg anhob, war die deutsche „Zeitenwende“ innerhalb von drei Tagen beschlossen. Irre. Erwähnte ich, dass der Mensch ein territoriales Wesen sei? Vielleicht gibt es unter den Menschen einfach Hof- und Hütehunde? Kann sein, wir Pazifisten sind die Schoßhunde unter denen. — Derlei halbernste Spekulation aber nur am Rande. Natürlich bin ich in Wirklichkeit kein Anhänger davon, dass komplexe Merkmale (wie die Einstellung zum Krieg) genetisch determiniert oder züchtbar seien. Dennoch vermute ich, dass Kriege, und auch nur der ferne Anblick von Gewalt oder Grenzverletzungen reflexartig eine Persönlichkeitsmatrix abrufen können, die etwas mit Gerechtigkeitssinn und Fähigkeit zu Aggression, Bestrafung und vermutlich auch Territorialität zu tun hat.
Bleiben wir vernünftig; bleiben wir beim ersten Argument; das mit dem zivilisatorischen Rückschritt: Wie wirkt sich unser hypothetischer Superstaat — im Extremfall der einzige Staat, den es noch gäbe — auf den zivilisatorischen Fortschritt, bzw. auf die Zivilgesellschaft aus? Für uns ist der schlechteste Fall am interessantesten, also der, in dem die Usurpater ein Regime krasser Ungleichheit, gemeiner Unterdrückung und staatsterroristischer Gewalt gegen alle nicht-Usurpater errichten wollen, ein Regime mit politischen Verfolgung, inklusive Straflager, Folter und Tötung, der politischen Indoktrinierung ihrer Kinder etc. Mit Hinweis auf solche Konsequenzen wird ja im allgemeinen der Verteidigungskrieg gerechtfertigt. Gut. Untersuchen wir diesen Fall.
Zuerst einmal ist das Erreichenkönnen und Stabilisieren eines solchen Gewaltregimes auf der ganzen Erde sehr fragwürdig. Ich vermute, dass ein globaler Allvölkerstaat, so einleuchtend er zunächst scheinen mag, wahrscheinlich (leider?) nie zu haben sein wird; und wenn, dann nur über den Weg gradueller, sehr langsamer Angleichungsprozesse unter den Nationen (oder über furchtbare Katastrophen, deren Betracht ich einmal fortlasse). Aber das ist unser Problem gar nicht; sondern die Ausforschung des Vorwurfs eines globalen zivilisatorischen Rückschritts, der durch die Usurpater verursacht würde. Wir wissen schon, dass das Hauptargument dagegen lautet, dass der zivilisatorische Rückschritt sich bereits im ursprünglichen Reich der Usurpater hat ereignen müssen; und also nicht durch den Krieg verursacht war, sondern nur verbreitet. Die Ausbreitung selbst als das Problem hinzustellen ist offensichtlicher Unfug; rückständige Zustände bleiben rückständige Zustände, solange sie in der Welt sind und unerachtet der Anzahl von Menschen, die von ihnen betroffen sind. Ihre globale Überwindung ist Teil des universalistischen zivilisatorischen Fortschrittgedankens. Ein globaler Eroberungszug brächte vor allem dies zuwege, den ursprünglich vorhandenen und nun exportierten rückständigen Zuständen der Usurpater sehr viel mehr (innenpolitische) Gegner einzuhandeln; mit anderen Worten, ihre Überwindung dringlicher zu machen und tendenziell eher zu beschleunigen, anstatt sie in Enklaven der Rückständigkeit überdauern zu lassen.
Das ist das Eine. Das andere sind die praktischen Aspekte. Wenn wir einmal Russland als Reich der Usurpater annehmen — nur zur Illustration, weil es im Ukrainisch-russischen Krieg, der Anlass dieses Aufsatzes ist, um die geht — im Fall Russlands also wären das etwa 140 Millionen (wenn alle Bewohner Russlands die usurpatischen Ambitionen mitmachten), die sich vornehmen, 8 Milliarden Menschen auf 149 Millionen Quadratkilometern zu beherrschen. Good luck with that! Das derzeitige grossrussische Reich hat ja schon unübersehbare Schwierigkeiten, sich selbst beisammen zu halten. Nicht nur wären die Usurpater dann in einer absoluten Minderheit, sie wären auch massiv auf lokale Kollaborateure — Stadthalter — angewiesen. Sowas geht nie lange gut; die Stadthalter werden schnell eigene Emanzipations- und Sezessionsbestrebungen entwickeln. Das Ganze erwiese sich im Handumdrehen als undurchführbares Unternehmen.
Solche Gedanken lassen sich auch leicht empirisch erhärten. Man muss keine große Recherchearbeit leisten, um herauszufinden, dass solche, auf extremer Grausamkeit und Unterdrückung basierenden Reiche sich ein ums andere mal als instabil erwiesen haben und nie lange hielten. In der Regel kein Menschenalter, oft nichtmal ein halbes. Nazideutschland bestand 12 Jahre, der Faschismus in Japan vielleicht 10 Jahre, die roten Khmer herrschten etwa 5 Jahre, der Stalinismus dauerte — je nachdem, wie man zählen möchte 29 bis 78 Jahre, der spanische Franquismus hielt ungefähr 40 Jahre, die DDR — wenn man die in die Liste der Diktaturen aufnehmen wollte — auch 40 Jahre, Mao herrschte vielleicht 30 Jahre, der für seine Grausamkeit bekannte römische Kaiser Caligula lediglich 4 Jahre bis zu seiner Ermordung, das Apartheidsregime in Südafrika lebte etwa 45 Jahre usw. usw. — Es geht einfach nie lange mit solchen Diktaturen. Wie kurzlebig würde da eine Diktatur sein, die noch viel schwieriger politisch und logistisch zu organisieren ginge?
Ohne lukrative Angebote der Usurpater an ihre Unterworfenen gebe ich unserem hypothetischen Allvölkerstaat kein Jahr. Mit anderen Worten, er würde gar nicht erst als stabiles Gemeinwesen entstehen. Wenn wir also von Innenpolitik überhaupt reden wollen, bzw. von einem Zivilwesen; und also die Möglichkeiten zu Fort- oder Rückschritt überhaupt installieren wollten, dann müssten solche lukrativen Angebote her. — Wie aber könnten solche lukrativen Angebote aussehen? Nun: Es müsste ein Staat errichtet werden, in dem die meisten der in ihm wohnenden Gruppen wenigstens eine Art Stillhaltebonus für sich finden können. So hat sich das römische Reich erhalten können; so handhabte es die Sowjetunion in den von ihr beherrschten Staaten; und so hält es auch der derzeitige Welthegemon USA als „Soft-Power“. Wie man es dreht und wendet: Herrschaft lässt sich nur stabilisieren durch — jetzt kommt’s: Einen gewissen zivilisatorischen Fortschritt. Durch innenpolitische Kompromisse, die alle Beteiligten zumindest stillhalten lassen, wenn nicht sogar weitgehend zufrieden stellen. Das heisst: Auch im Falle eines zivilisatorischen Rückschritts müsste er mit einem Fortschritt erkauft werden.
Das ist ja der Grund, aus dem der zivilisatorische Fortschritt sich überhaupt ereignet: Weil es immer wieder neuer Kompromisse bedarf, um die Ordnung im Staat aufrecht zu halten. Kompromissunwillige Staaten haben sich — rein empirisch — als nicht sehr haltbar erwiesen, sobald die Menschheit eine gewisse technische Schwelle überschritten hatte. Diese Überschreitung ereignete sich im Jahr 332 vor unserer Zeitrechnung, dem Jahr, in dem Alexander Ägypten unterwarf. Ägypten war das letzte Reich, das trotz (relativ) konstanter Unterdrückungsverhältnisse stabil bleiben konnte. Seither müssen sich Staaten sehr viel elastischer zeigen, das heisst: fähig und willig zu zivilisatorischem Fortschritt, wenn sie nicht in sich zerbrechen und untergehen wollen; untergehen heisst: Den Platz für Staatswesen räumen, die kompromissbereiter und fortschrittsfähiger sind. Diese Entwicklung hat etwas mit ganz schnöden materiellen Umständen zu tun; damit dass es seit 332 BC Millionen und Milliarden von Menschen gibt (anstatt nur tausender), deren Zusammenleben organisiert werden muss; damit dass die technischen Möglichkeiten zur Organisation und zum Verbreiten von Informationen sich ständig vergrössern; damit dass die Waffentechnik immer weiter voran geschritten ist und selbst kleine bewaffnete Gruppen große Verheerungen anrichten können; damit, dass Staaten leistungsfähiger sind, in denen die Massen gebildet und in Schulen geschickt werden usw. usf.
(6) Grenzwertiges, zweiter Teil: Welchen Wert haben Grenzen überhaupt?
Unser Gedankenexperiment hat nicht nur die Leistungsfähigkeit von Kriegen zweifelhafter gemacht; es verschärft auch die Frage nach dem Wert von Grenzen. Was bleibt von der Artikel-2-Heiligkeit des Territoriums, wenn wir einmal in Gedanken auf den Krieg verzichteten, den seine Verletzung unweigerlich hervor zu rufen scheint? Gibt es über diese Kriegsvermeidung etwas am Territorium selbst, das schützenswert ist, bzw. am Verlauf einer Grenze? Was sind territoriale Grenzen eigentlich? Sind sie am Ende etwas Lebendiges oder Lebensnotwendiges für die Menschen?
Die Analogie eines Hauses fällt jedem spontan ein. Häuser bieten Schutz vor der Natur und ermöglichen recht fundamental das Leben der Menschen in modernen Gesellschaften, in denen sie mit Individualrechten ausgestattet sind. Häuser machen auch augenfällig, was Eigentum sein soll (grob: die Gegenstände in den in den Häusern), auch wenn Eigentum natürlich sehr viel komplexer ist, als das. Häuser, aufs simpelste gesagt, schützen und ermöglichen. Sind Staatsgrenzen also die Häuser der Gesellschaft?
Ich würde sagen: Im Grunde ja. Staatsgrenzen markieren, nüchtern betrachtet, Verwaltungsbefugnisse; sehr ähnlich den eigenen vier Wänden. So, wie ich in denen Dinge tun darf (zB aussprechen, was mir in den Sinn kommt, nackig durch die Zimmer turnen etc.) umreissen Grenzen das räumliche, physische Gebiet, innerhalb dessen die Institutionen und Gesetze eines Staates gelten. Ein Staatswesen kann nicht ins Leben treten oder wirksam sein ohne Staatsbürger und ohne Staatsgebiet. Hat er aber diese und jenes, spielt es eine untergeordnete Rolle, ob es sich um Hundert Tausend oder Hundert Millionen Staatsbürger handelt; wie es auch (für Dasein und Funktionalität des Staates) recht unerheblich ist, ob das Staatsgebiet Hundert oder Zehnmillionen Quadratkilometer umfasst. Für das reine Herstellen eines Gemeinwesens ist es also egal, wo die Grenzen verlaufen; nicht aber, dass es sie gibt. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ein Staatsgebiet lediglich ödes Land umfasst, oder reiche, fruchtbare Gebiete; ob es an wichtigen Verkehrswegen gelegen ist, oder abseits von denen. Es macht einen Unterschied für den Reichtum eines Staates und für seine internationale Rolle. Manche Staaten werden es wegen ihrer territorialen Lage schwerer haben, als andere. Das alles ist wahr und betrifft sicher Eifersüchte zwischen den Nationen und Kriegsgelüste. Aber es betrifft nicht (zumindest nicht unmittelbar) die prinzipielle Fähigkeit eines Staates zur Einrichtung des zivilisatorischen Fortschritts.
Sind Grenzen deswegen heilig? Das nun auch nicht. Vielmehr tritt ein seltsames Paradox auf: Der Verlauf von Grenzen wird in dem Moment unsichtbar und irrelevant, sobald niemand mehr wünscht, ihren Verlauf zu verändern. Mit anderen Worten, sobald der Verlauf einer Grenze von allen Anrainern anerkannt wird, ist es fast, als sei sie gar nicht vorhanden. Grenzen haben in dieser Hinsicht viel mit einer optischen Täuschung, wie der untenstehenden gemein: Die schwarzen Punkte, die in den weißen Kreuzungspunkten auftauchen, verschwinden, sobald man hinschaut. Genauso verhält es sich mit Grenzen, nur umgekehrt: Sie tauchen erst auf, sobald man hinschaut.
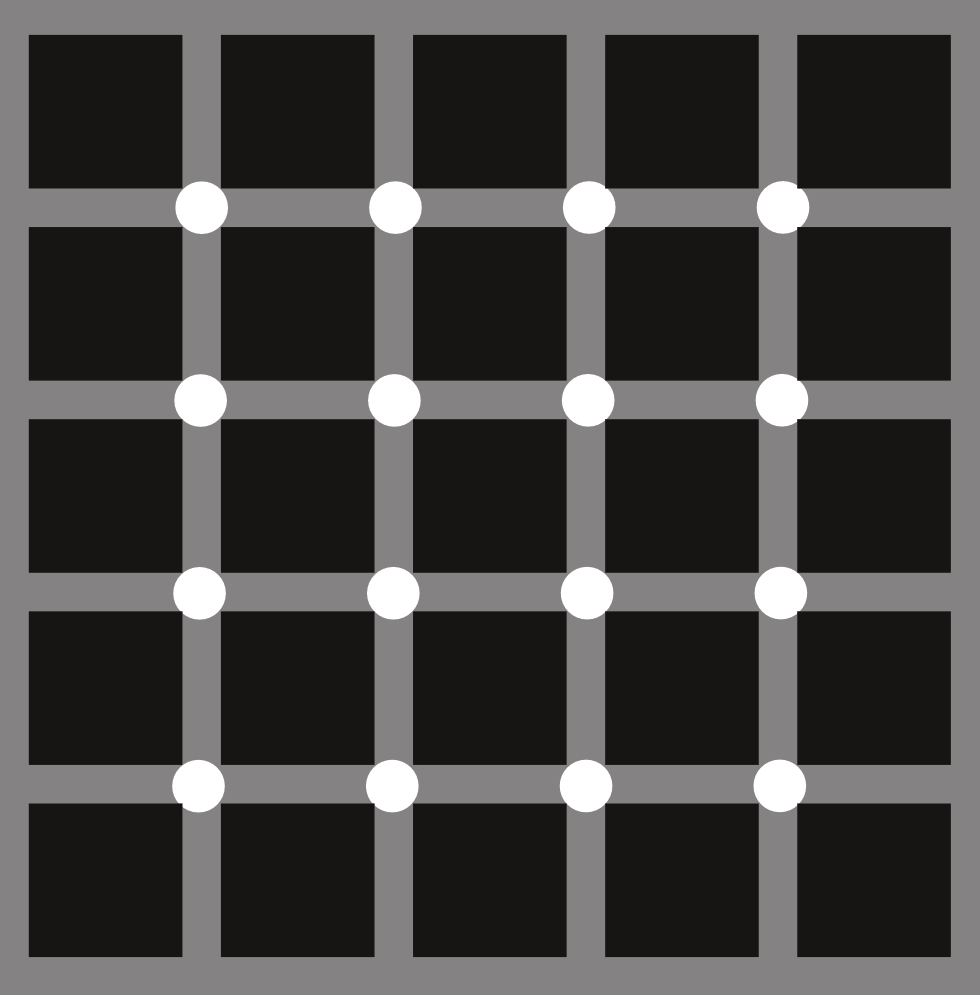
Zum Beispiel in der EU. Die Grenzen zwischen ihren Mitgliedsstaaten haben wenig mit dem gemein, was seit der Antike bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts eine Grenze war: Es sind praktisch nur noch Demarkationen von Verwaltungsbefugnissen. Die Anrainer können sie jederzeit übertreten, es gibt keine Passkontrollen, keine Visumspflichten, keine herunter gelassenen Schlagbäume, keine Zölle, keine Schutzarmeen und so weiter. Stattdessen gibt es gemeinsame Verteidigungsdoktrinen (d.h. ein tatsächlich eingeübtes und technisch umgesetztes Zusammen der nationalen Armeen), ein gemeinsames Parlament, gemeinsam abgehaltene transnationale Wahlen usw. Die EU liesse sich — in großen Teilen — genauso gut als Vielvölkerstaat mit verschieden autonomen Provinzen auffassen (und ich wäre froh, wenn sie eines Tages tatsächlich dahin kommen könnte, auch wenn die gegenwärtige politische Entwicklung diese Hoffnung nicht eben bestärkt). Sie ist ein gutes Beispiel für Föderalismus als Aufhebung des Gegensatzes zwischen Autonomie und Heteronomie der Nationen. So ungefähr denke ich mir jedenfalls den Beginn des Auftretens von Vernunft im Aussenpolitischen.
Soweit mein Plädoyer, dem Krieg seine ihm nachgesagten Fähigkeiten nicht weiter zu glauben. Ich habe meinen Punkt, denke ich, hinreichend deutlich gemacht. Wer den bis hier vorgetragenen Argumenten halbwegs folgt, ist meines Erachtens gezwungen, die Zweckrichtigkeit von Kriegen (teils im Unterschied zu ihrer Berechtigung) erheblich zu überdenken. Natürlich werden nicht alle Leserinnen folgen wollen. Ihren Argumenten und ihrer Widerrede widme ich den zweiten Teil dieses Aufsatzes.
Teil 2, Einwände: Der zweite Weltkrieg. Bürgerkriege.
Wir werden uns mit zwei gewichtigen Einwänden befassen müssen, mit Bürgerkriegen und mit dem zweiten Weltkrieg. Bürgerkriege sind in mindestens zweifacher Hinsicht ein Einwand gegen das Gebrachte: Einmal dadurch, dass mit Ihnen zumeist keine territorialen Grenzen verschoben werden sollen. Tatsächlich tobten sie oft um Gegenstände des zivilisatorischen Fortschritts, wie zum Beispiel um die Abschaffung der Sklaverei oder um die Einführung von Bodenreformen bzw. Überführung von Privat- in Gemeineigentum oder um die Reformation der Bezugnahme auf Gott. Können Bürgerkriege also mehr für den zivilisatorischen Fortschritt leisten, als Kriege zwischen Staaten?
Weiterhin könnten Bürgerkriege zu einem Einwand gemacht werden, weil sich (von einer Mondwarte aus) selbst Kriege zwischen Staaten als Streit über eine Verwaltungsreform auffassen lassen, bei der es lediglich um die Festlegung von Verwaltungsgrenzen geht. Liesse sich durch ein solches „Reframing“ nicht jeder Krieg als eine Form des Bürgerkriegs auffassen? Was uns zur Generalisierung dieses Einwands bringt: Natürlich verschwindet die Leistungsfähigkeit von Kriegen, wenn wir die Menschheitsperspektive einnehmen. Die Menschheit als Ganzes kennt eben keine Grenzen; also bringt jede Tätigkeit, deren Hauptsinn darin besteht, Grenzen zu verschieben, die Menschheit als Ganzes nicht voran. Das, so der Einwand, ist trivial und weniger ein Argument, als eine Frage der Perspektive. Der Pazifist lebt eben auf dem Mond.
Der zweite Weltkrieg hinwieder ist ein gewichtiges Gegenargument, weil sein Ausgang unsere derzeitige Überzeugung, dass Kriege unter Umständen doch Beachtliches hinsichtlich des zivilisatorischen Fortschritts leisten können, maßgeblich bestimmt. Genereller halte ich dafür, dass es im zwanzigsten Jahrhundert drei Hauptereignisse gab, die miteinander wettstreiten, unsere Wahrnehmung dessen, was Kriege tatsächlich leisten, zu bestimmen: Den ersten Weltkrieg, den zweiten Weltkrieg und die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Nun hat jedes dieser drei Ereignisse sicher seine ganz eigene Botschaften, aber hinsichtlich des zivilisatorischen Fortschritts stehen der erste Weltkrieg und die Atombombenabwürfe auf einer gemeinsamen Seite: Ihre Lehre lautet, dass Kriege zwischen modernen Armeen (aus letztlich militärtechnischen Gründen) keinen zivilisatorischen Fortschritt erzielen können, sondern, im Gegenteil, erreichte zivilisatorische Höhe nur zerstören oder — im Fall der Atombombe — Zivilisation und Geschichte gleich gänzlich beenden. Dem steht die Lehre des zweiten Weltkriegs gegenüber, es könne ein konsequent geführter Krieg durchaus zweckdienlich sein, um ein unmenschliches politisches System wie den Nationalsozialismus zu besiegen und abzuschaffen.
Beide Einwände halte ich für stark und stichhaltig. Trotzdem will ich versuchen, ihnen ihre größte argumentative Kraft zu nehmen. Ich glaube nicht, dass diese Einwände gänzlich falsch oder abwegig sind; ich glaube aber, dass sie mein Argument nicht so stark gefährden oder gar widerlegen, wie es den Anschein hat.
(1) Der zweite Weltkrieg: Die seltene Ausnahme?
Beginnen wir mit dem zweiten Weltkrieg, der geleistet hätte, nicht nur Deutschland, sondern auch den Nationalsozialismus zu besiegen. Verfechter dieses Argumentes behaupten, dass im Ergebnis des zweiten Weltkrieges nicht nur der Aggressor militärisch besiegt und für das Verbrechen des Krieges mit Reparationen und Besatzung zur Verantwortung gezogen, sondern auch der zivilisatorische Fortschritt nach Deutschland exportiert worden wäre. Letzteres wäre durch die von den Besatzern forcierte Installation demokratischer Verfassungen samt der dafür nötigen staatlichen Institutionen geschehen; sowie durch ein umfassendes Umerziehungs-, Aufklärungs- und Bildungsprogramm (inklusive der Entfernung von Nazis aus Staats- und Lehr-Ämtern). Und ich lasse einmal den Umstand unbeachtet, dass die Denazifizierung natürlich nicht so gründlich und umfassend war, wie in der vorherrschenden Siegererzählung gern behauptet und stattdessen in beiden Teilen Deutschlands ehemalige Nazis sich in einflussreichen Positionen wiederfanden (im Westteil eklatanter, als im Osten).
Solche Einzelheiten sind wichtig für Historiker, für Politiker und für die Menschen jener Tage; indes, für die Philosophie des Pazifismus spielen sie nur eine untergeordnete Rolle. Für die ist die generelle Frage wichtig, was dran ist an der Behauptung, dass in diesem Fall ein Krieg tatsächlich einmal einen zivilisatorischen Fortschritt hat bewirken können? Die Behauptung lässt sich sogar noch erweitern: Auch die EU und die Vereinten Nationen seien ein zivilisatorischer Fortschritt, der in letzter Konsequenz dem zweiten Weltkrieg zu danken wäre.
Mein wichtigstes Argument in der Sache habe ich schon gebracht: Auch der zweite Weltkrieg hat die Demokratie in Deutschland nicht errichtet oder ihre Saat gesät, sondern sie bestenfalls aus den Siegermächten — wo sie schon vorhanden war und ihre eigentliche Einrichtung vonstatten ging — nach Deutschland exportiert. Erfunden und ins Werk wurde die Demokratie in anderen Prozessen. Man wird wahrscheinlich erwidern, transportieren reichte. Es genügte, wenn Kriege den zivilisatorischen Fortschritt nur exportieren könnten (anstatt ihn zu erzeugen). Hiergegen versetze ich (neben dem schon gesagten), dass mir die Transportfähigkeit, die Kriege bislang für den zivilen Fortschritt bewiesen hätten, durchaus zweifelhaft vorkommt.
Wie also steht es? Kann der Ausgang des zweiten Weltkrieges als Beleg für die Fähigkeit von Kriegen herhalten, zivilisatorischen Fortschritt, wenn schon nicht herzustellen, so doch wenigstens zu transportieren? Ich meine: Ein bisschen vielleicht, aber im Wesentlichen nein. Zunächst einmal macht es ja mißtrauisch, dass allein der zweite Weltkrieg sowas vermochte. Mir fällt kein anderer Krieg zwischen Staaten ein, von dem die hauptsächliche Deutung lautet, er hätte einen zivilen Fortschritt bewirkt. Nicht der erste Weltkrieg, nicht der Koreakrieg, nicht der Vietnamkrieg, nicht der Falklandkrieg, nicht die verschiedenen Kriege in Afghanistan, nicht der Golfkrieg und nicht der Irakkrieg und auch nicht die zahlreichen Kriege des Nahostkonflikts. Der zweite Weltkrieg, mithin, scheint in dieser Hinsicht ein Sonderfall. Wann immer sonst ein Krieg behauptet hat, eine Tyrannei abzuschaffen, Demokratie zu exportieren, den Menschen im Kampfgebiet zu ihrem Recht zu verhelfen usw., scheint diese Mission mißlungen zu sein. Ich finde das verdächtig. Es kann bedeuten, dass die Absichten der fortschrittsbringenden Kriegspartei am Ende doch nicht so hehr waren, wie behauptet; oder, dass hehre Absichten zwar am Werke waren, aber ihre Umsetzung fast immer ungenügend oder unmöglich.
Allenfalls beim Kosovokrieg könnte man konzedieren, dass das Eingreifen der NATO wennzwar nicht bessere oder gerechtere Zustände geschaffen, so doch wenigstens ein unnötiges Fortdauern des Krieges herbei geführt haben könnte. Aber man muss zugeben, dass es darum gar nicht geht: Dass man Krieg führen kann, um andere Kriege zu beenden, zählt nicht zu den von mir bestrittenen Fähigkeiten von Kriegen. Sowas können Kriege manchmal. Auf eine Weise ist das trivial; jeder Krieg wird durch den Verlauf des Krieges beendet. Und zum andern betrifft es nicht das hier Interessierende; nicht den Krieg soll er beenden, sondern den Frieden verbessern, den Fortschritt exportieren. Ich möchte nicht erst einen Krieg beginnen müssen, um vom Krieg die gute Eigenschaft lobpreisen können, dass sein Verlauf dazu beitragen kann, endlich sein eigenes Ende zu finden.
Warum aber konnte im zweiten Weltkrieg gelingen, was sonst in hässlicher Regelmässigkeit zu mißlingen scheint, dass nämlich ein Terrorregime abdankte, um einem demokratischen Staatswesen Platz zu machen? Zunächst ganz einfach, weil es in Deutschland bereits vor den Nazis beachtliche demokratische Kräfte gab, an deren Tradition die Alliierten anknüpfen konnten. Ja, es stimmt, die Nazis hatten ein totalitäres Unterdrückungsregime mit Millionen Kollaborateuren und Profiteuren errichtet, ja, es stimmt, dass die NSDAP 1945 gut 10 Millionen Mitglieder hatte; auf dem Papier war ein Sechstel aller Deutschen Nazis. Aber es stimmt ebenfalls, dass es seit der Novemberrevolution 1918 und dem Abdanken des Kaisers ein demokratisch wählbares Parlament in Deutschland gab; dass Verhältnis- und das Frauenwahlrecht eingeführt waren. Viele demokratische Rechte waren bereits erstritten, oft blutig und unter Opfern, das Streikrecht, das Recht auf freie Meinungsäusserung, Versammlungsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit usw. Tatsächlich reichen die demokratischen Wurzeln Deutschlands sogar weit vor Weimar; die Frankfurter Reichsverfassung von 1849 war zB. ein erster beachtlicher Versuch, Deutschland ein demokratisches Grundgesetz zu geben, das weite Teile des heutigen Grundgesetzes bereits vorwegnahm oder inspirierte. Mit anderen Worten: Die obsiegenden Besatzungsmächte fanden demokratisch gesinnte Menschen und einen breiten Fundus an Geschichte, Biographien und demokratischen Gedanken vor, an den sie anknüpfen konnten. Eine Demokratie musste gar nicht nach Deutschland exportiert werden; man konnte sich des Vorhandenen bedienen.
Der zivilisatorische Fortschritt in Deutschland war längst da; er war nur unter dem Regime der Nazis unterdrückt und nicht sichtbar. Es war nicht die Leistung des Krieges und nicht die der Alliierten, eine überlegene zivile Ordnung nach Deutschland exportiert zu haben. Sie konnten nach dem Sieg vor Ort mit ihren demokratisch gesonnenen deutschen Verbündeten zusammen arbeiten; und das ist schon das ganze Geheimnis ihres „Exports“. Maximal lässt sich also sagen, der militärische Erfolg hätte die Voraussetzung für diese Zusammenarbeit geschaffen und den vorhandenen demokratischen Kräften Zeit und Raum für ihr Wiedererstarken gegeben. Gut. Setzt man aber diese Wirkung zum Mittel des Krieges ins Verhältnis, wird man einräumen müssen, dass übertrieben wäre, von einem zweckrichtigen Mittel zu reden. Genauso wenig, wie uns zweckrichtig scheint, den Schmerz, den ein eingetretener Dorn verursacht, durch Abhacken des Fußes zu beheben. Ja, der Dorn tut dann nicht mehr weh… Innenpolitische Prozesse mögen länger brauchen, wenn man sie nicht von aussen rabiat beschleunigen will, aber sie heilen sehr viel besser.
Nocheins. Zur Frage, wie der Nationalsozialismus tatsächlich besiegt wurde (man fragt sich heute: wurde er überhaupt je „besiegt“)?. Für die damalige Zeit jedenfalls lautet die Antwort: Der Nationalsozialismus hat selbst nicht wenig zu seiner Niederlage beigetragen. Eine Idee, heisst es, könne man nicht einsperren oder totschiessen. So sehe ich es auch. Politische Ideen können nur verschwinden oder an Einfluss verlieren, indem sie sich selbst widerlegen (oder indem sie veralten, d.h. die Bedingungen, unter denen sie bedeutsam werden können, nicht mehr vorhanden sind). Der deutsche Nationalsozialismus hat sich in den furchtbaren zwölf Jahren seiner Macht sehr um seine eigene Widerlegung verdient gemacht. Auch und gerade in Deutschland. Er hatte einen sinnlosen Krieg mit Millionen Toten losgetreten und eine ganze Generation ihrer Jugend beraubt. Er hatte die Deutschen ihrer hart erstrittenen demokratischen Rechte beraubt; seine eigene Bevölkerung überwacht, denunziert, terrorisiert, an Geist und Körper geschändet. Er war auf so vielen Ebenen — politisch, moralisch, intellektuell und sogar ästhetisch — ein derart augenfälliger Bankerott, dass er nach 12 Jahren kaum noch Anhänger fand, die wirklich für ihn kämpfen wollten. Wie anders steht es da um andere Ideologien, die auch nach militärischer Niederwerfung in jahrzehntelangen Untergrund und Widerstand mündeten (nationale Befreiungsbewegungen, religiöse Splittergruppen usw). Dass es nach dem Sieg der Alliierten keinen nennenswerten nationalsozialistischen Untergrund gab, lag auch daran, dass niemand, der bei Troste war, für diesen Mist noch hatte kämpfen wollen. Die Besiegung des Nationalsozialismus als Ideologie, will ich sagen, hat er zu grossen Teilen selbst besorgt.
Natürlich wollen seine militärischen Bezwinger ihm diesen politischen Selbstmord nicht schenken. Sie hätten ihn gern selbst erwürgt. Immerhin, soviel lässt sich zugeben, dass die Besatzungsmächte sowohl während des Krieges, als auch nach ihrem Sieg rege Aufklärungsarbeit über die Verbrechen der Nazis trieben. Das Verdienst, soll ihnen nicht abgesprochen sein. Die Deutschen würden heute vermutlich in sehr viel weitgehenderer Verdrängung ihrer Nazi-Vergangenheit leben, wenn ihnen ihre drastische militärische Niederlage inklusive Besatzung erspart geblieben wäre. Soweit würde ich dem Argument auch zustimmen. Die militärische Niederlage Nazideutschlands und die Besatzungszeit haben etwas zur demokratischen Kultur des Landes beigetragen. Aber der zivilisatorische Fortschritt hätte sich — des bin ich überzeugt — auch ohne das durchgesetzt. So, wie der Faschismus in Spanien verschwand; so, wie letztlich alle totalitären Regimes verschwinden: Durch innenpolitische Kämpfe. Das geschieht nicht automatisch und mag kein Naturgesetz sein, aber es gibt — über längere Zeiträume betrachtet — so gut wie keine empirischen Gegenbeispiele. Das ist doch schonmal was.
Und wie verhält es sich mit Argument, UN und EU wären doch aber zivilisatorische Fortschritte, die wir dem zweiten Weltkrieg verdanken? Ich bin d’accord, dass das institutionsgewordene Lehren aus dem zweiten Weltkrieg sind. Sie entstanden so, wie die Menschheit aus Katastrophen halt lernt. Ein bisschen. Kaum genug. Aus dem bisschen Gelerne zu folgern, man dürfe die Katastrophe herbeiführen, damit sich die Menschheit zivilisatorisch hinauf bequeme, ist offensichtlich Blödsinn. Es reicht, um klüger zu werden, dass wir uns die Katastrophe vorstellen können. Man muss keine Städte niederbrennen, um die Notwendigkeit einer Feuerwehr einzusehen.
Soviel von der angeblichen Lehre des zweiten Weltkrieges. Recht besehen war er nicht so verschieden von anderen, gewöhnlichen Kriegen. Die Ausnahme, in der ein Krieg einmal die Welt zivilisatorisch hätte heraufbilden können, ist er nicht wirklich. Unterschiedliche Kriege können dennoch durchaus unterschiedliche Botschaften und Interpretationen haben. Die wirklich neuen Kriegslehren sind meines Erachtens aber lediglich jene, die sich aus dem Stand und der Fortentwicklung der Militärtechnik ableiten lassen. Die Neuigkeit des ersten Weltkrieges bestand eben in der gesteigerten Destruktivität von Kriegen im industriellen Zeitalter; aber vor allem darin, dass grössere Gebietseroberungen absehbar nicht mehr möglich sein würden — wegen der zerstörerischen Kraft der neuen Waffen. Grosse Feldzüge unter technisch Gleichgerüsteten waren im zwanzigsten Jahrhundert ungewinnbar geworden. Der zweite Weltkrieg mit seinen tausende Kilometer ausgreifenden Frontverläufen scheint dieser Lehre zu widersprechen; aber er bestätigte sie letztlich durch die Unhaltbarkeit all dieser Fronten. Der erste Weltkrieg war der wirklich wichtige, wenn wir in die Militärgeschichte schauen; vielleicht der wichtigste Krieg überhaupt in der gesamten Militärgeschichte der Menschheit. Ich halte dafür, dass sich die Lehren des ersten Weltkriegs seither immer und immer wieder bestätigt haben, in so gut wie allen nach ihm stattgehabten Kriegen. Deshalb haben die Amerikaner in Vietnam verloren und die NATO in Afghanistan etc. — weil es militärtechnisch nicht mehr möglich ist, einen mit halbwegs modernen bewaffneten Gegner dauerhaft und entscheidend niederzuwerfen. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki verschärfen die Botschaft des ersten Weltkrieges nur: Ein Krieg zwischen Atommächten wäre nicht nur ungewinnbar, sondern führte das Ende der Menschheit herbei. Das sind, sehr kurz gesagt, die wirklichen Botschaften der Kriege des zwanzigsten Jahrhunderts. Möglicherweise ändert sich das alles mit den Lehren des Ukrainekrieges nocheinmal. Die Implikationen von Drohnen- und KI-Technik scheinen noch nicht ganz ausgemacht. Mein Eindruck ist: Es läuft wieder auf die Botschaft des ersten Weltkrieges hinaus. So sehr man auch militärisch weiter rüstet, es ändert sich wohl wenig an der Tatsache, dass grössere Kriege in einer industrialisierten Welt nicht mehr gewinnbar sind. Natürlich werden Militärs diese Botschaft nie in dieser schieren Einfachheit verstehen oder zugeben. Es ist ja ihr Beruf, Kriege für gewinnbar zu halten. Und wer wollte schon von Beruf auf verlorenem Posten arbeiten?
(2) Bürgerkriege. Wozu den noch erhalten, der Dich nicht erhält?
Komme ich an den zweiten Einwand: Was vermag unser Argument gegen die Zweckrichtigkeit von Bürgerkriegen? Der Einwand betrifft im Grunde alle Kriege, die nicht in der Absicht geführt werden, Grenzen zu verschieben. Was aber spricht zum Beispiel gegen den Krieg zur Abschaffung der Sklaverei? Hätte nicht wenigstens dieser Krieg ganz unbestreitbar einen zivilisatorischen Fortschritt gewollt und bewirkt?
Der Einwand lässt sich generalisieren: Was, wenn unser Argument lediglich willkürlich die Perspektive wechselte; nämlich von der Nation zur Menschheit? Es scheint trivial, dass in allem, was die Menschheit als Ganzes betrifft (Universalismus, zivilisatorischer Fortschritt etc.), Grenzen keine Rolle spielen. Wir denken sie uns ja gerade fort, um die Menschheit als Ganzes denken zu können. Für die Nation, den Staatsbürger und die bürgerlichen Rechte hinwieder scheinen territoriale Grenzen eine Voraussetzung. Das ganze Argument wäre ein großer Schwindel; es bewiese lediglich, was ich in der Voraussetzung (es ginge um die Menschheit als Ganzes) längst zum Beweisgedanken passend gemacht hätte.
Beiden Einwänden muss ich zunächst einmal stattgeben. Sie widerreden vernünftig. Ja, gegen Kriege, die tatsächlich und nachweislich zu anderen Zwecken, als zum Verschieben oder Erhalten territorialer Grenzen — und insbesondere zum Durchsetzen zivilisatorischen Fortschritts geführt werden, wie zB. der amerikanische Bürgerkrieg — gegen solche Kriege ist mein Argument weitgehend zahnlos. Und auch gegen das zweite Argument, ich würde im Wesentlichen die Menschheitsperspektive einnehmen, um dann trivialerweise die Sinnlosigkeit von Kriegen zu behaupten, kann ich mich nur schwer wehren.
Verweilen wir zunächst bei dem. Muss ich mich denn überhaupt wehren? In der Tat, ich nehme in meinem Argument konsequent die Menschheitsperspektive ein; und beharre darauf, dass sie (aus Sicht der Geschichte und dem, was uns wirklich interessieren sollte) die rechte Perspektive sei. Umgekehrt glaube ich, dass Menschen, die den Krieg fallweise als zweckrichtiges Mittel ansehen, im Grunde die Menschheitsperspektive verlassen, um ihre partikularen Interessen für die Dauer des Ausnahmemachens höher einzustufen, als den zivilisatorischen Fortschritt der Menschheit. Nach dem Ausnahmemachen würde die Menschheitsperspektive natürlich wieder gelten. Ich finde das so inkonsistent, wie moralisch fragwürdig. Hier geht es aber nur um die Inkonsistenz: Konsistent, im Sinne von in sich widerspruchslos, kann nur sein, entweder die Menschheitsperspektive und mit ihm den Universalismus als Ganzes abzulehnen. Oder, wenn man die Menschheitsperspektive einmal mitmacht, auch mein Argument für den Pazifismus zu akzeptieren; dann stimmt eben („trivialerweise“), dass Kriege keine zweckrichtigen Mittel zur Beförderung der Menschheitssache sind und Kriege aus „humanistischen Gründen“ ihren Zweck nicht einlösen können. Man muss sich entscheiden: Menschheitsperspektive, ja oder nein. „Ein bisschen Universalismus“ geht genauso wenig, wie „ein bisschen schwanger“, weil der Universalismus zentral die Forderung beinhaltet, die Ausnahme vom Recht bzw. das Privileg abzuschaffen. Dazu zählt das fallweise Recht zum Krieg, das einer Nation je nach Gusto eingeräumt oder nicht eingeräumt wird. Der Pazifismus erhebt die Forderung, keinem Staat dieses Recht einzuräumen; ausnahmslos nicht, das heisst: auch nicht fallweise. Eine (von vielen möglichen) Begründungen für diese Forderung ist mein hier vorgebrachtes geschichtsphilosophisches Argument.
Es ist dennoch wichtig, zu verstehen, dass es vor allem ein Argument der Friedenszeit ist; sich also auf jene Phasen der Geschichte bezieht, in denen ein Staat keinen Krieg mit anderen Staaten führt. Der Pazifismus, den ich meine, beginnt nicht erst, wenn der Krieg eingetreten ist; vielmehr zielt er darauf ab, die Zivilgesellschaft so stark zu machen, einen Krieg schon im Entstehen zu verhindern. Das ist der zivilisatorische Fortschritt, den ich meine; Rechte und Institutionen. Praktisch und zentral zielt mein Argument auf die Abschaffung des Kriegsrechts und auf die Schaffung von demokratischen Mechanismen, die den Einzelnen davor schützen, an Kriegen teilnehmen zu müssen.
Natürlich kann man den Fall nicht ausschliessen, dass sich demokratische Mehrheiten für einen Krieg ergeben. Zwar zielt mein Trachten auf eine allgemeine Hebung der Gesittung, so dass sich eines Tages keine Mehrheiten mehr für das organisierte Einanderumbringen finden; aber ich räume ein, dass die momentanen Ereignisse derlei Optimismus nicht unbedingt nahe legen. Deshalb lasse ich mein Argument zunächst zu der Minimalforderung gestutzt, dass sowohl die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft bleibt, als auch im Kriegsfall alle Menschen, die keine Lust auf Teilnahme am Krieg verspüren, nicht dazu gezwungen werden dürfen. Gleichfalls sollen dem Staat die Möglichkeiten beschnitten werden, für Krieg und Militär zu werben; finanzielle Anreize sollen minimiert werden, der Soldatensold sollte das Bürgergeld nicht überschreiten und keine Gefallenen- und Hinterbliebenenrenten ausgelobt. Die Armee, mit anderen Worten, sollte eine Art freiwillige Feuerwehr werden. Das kommt mir demokratisch vor und mit der Idee eines zivilisatorischen Fortschritts vereinbar. Vielleicht kann die Schweiz als Vorbild gelten.
Zum zweiten Teil des Perspektiv-Argumentes. Auch ich hätte eingeräumt, dass territoriale Grenzen Voraussetzung jeder zivilisatorischen Ordnung seien. Ihre Verletzung sei also ein Niederreissen jener Voraussetzungen bzw. ihr Schutz nichts weniger, als das Fundament von allem, was die Menschheit sonst als zivilisatorischen Fortschritt leisten könne. Im Grunde läuft das auf eine Wiederholung dessen heraus, was ich schon gesagt habe; bleibt das bislang Ungesagte nachzutragen. Gesagt war: Ja, Grenzen schon, aber irgendwelche. Jede Grenze ist so gut, wie jede andere. Es hat — aus der Mond- oder Menschheitsperspektive — keinen Sinn, den bestehenden Verlauf mit Krallen und Toten zu schützen, wenn am Ende die Menschheitsaufgaben unverändert bestehen bleiben. Schlimmer noch, das Verteidigen wirft uns zivilisatorisch zurück. Dass, was wir schützen wollen, geben wir durch die Art, wie wir es beschützen, auf.
Das war schon gesagt. Ungesagt blieb der Wirkbreich des Arguments: Da, wo die resultierenden Grenzen so ungünstig verlaufen, dass realistisch nicht daran zu denken ist, innerhalb des von ihnen markierten Territoriums ein halbwegs funktionables Gemeinwesen einzurichten. Ein Beispiel scheint mir das unzusammenhängende Staatsgebiet Palästinas, Gazastreifen und Westbank. Ich vermute, diese Gebiete sind zu klein und ungünstig gelegen, um in ihnen einen Staat zu errichten. Es gibt zwar Staatsgebiete, die noch kleiner sind (Andorra, Liechtenstein, Singapur, Bahrein etc), aber sie haben alle „offene Grenzen“, d.h. sie sind für ihr Funktionieren und Überleben darauf angewiesen, dass Handel und Reisetätigkeit ihrer Bürger sehr weitgehend ermöglicht ist. Schlösse man sie ein, wären sie nicht überlebensfähig. Eine (von vielen) Voraussetzungen für eine haltbare Zweistaatenlösung im nahen Osten wären also durchlässige Grenzen; was Wiederhin zur Voraussetzung hat, dass sowohl Palästinena, als auch Israel, Kontrolle über die kriegswilligen Extremisten in ihrer Bevölkerung erlangen. Das ist das Hauptdilemma dieses Konflikts: Beide Seiten haben es bislang nicht vermocht, ein Staatswesen einzurichten (i.e. einen zivilen Stand zu erreichen), in dem sie den extremen Kräften in den eigenen Reihen Einhalt gebieten können. Die Israelis nicht den Siedlern, Orthodoxen und Rechtsextremen; und die Palästinenser nicht der Hamas und den anderen radikalen Splittergruppen. Das wiederum verunmöglicht die Einrichtung offener Grenzen (Grenzen, wir erinnern uns, über die keiner mehr nachdenken muss, so dass sie gleichsam verschwinden); und das verhindert die sog. Zweistaatenlösung. Für dieses Beispiel also lässt sich mein Argument so ausbuchstabieren: Voraussetzung für einen Frieden im nahen Osten wäre ein zivilisatorischer Fortschritt, der auf beiden Seiten eine Regierung schafft, die tatsächlich „Herr im Hause“ ist (oder Frau) und für die gesamte Bevölkerung so sprechen kann, dass sich diese Bevölkerung auch an die Beschlüsse und Gesetze hält, die diese Regierungen aushandeln und erlassen. Es kommt mir seltsam vor, dass die gesamte Debatte seit Jahrzehnten um diese einfache und augenfällige Wahrheit herumdiskutiert, als gäbe es sie nicht.
Komme ich als letztes an den stichhaltigsten und stärksten Einwand: Was nun mit Bürgerkriegen sei; oder mit Strafexpeditionen, mit staatlich unterstützten Terroranschlägen etc.; also mit kriegerischer Gewalt, deren Ziel nachweislich nicht die Verschiebung territorialer Grenzen ist, sondern vielleicht sogar wirklich das Inswerksetzen oder Befördern eines zivilisatorischen Fortschritts?
Ich habe bereits eingeräumt, dass mein Argument nicht viel gegen solche Formen des Krieges vermag. Ich erachte das nicht als Widerlegung. Jedes Argument hat Grenzen und Wirkbereiche, so auch meins. Mir reicht, ein Argument gegen grenzverschiebende Kriege zu haben, das nicht so leicht von der Hand zu weisen geht. Gegen Bürgerkriege müssen andere Argumente her; und ich fürchte einerseits und hoffe andererseits, dass das Ausarbeiten solcher Argumente die künftige Hauptaufgabe der Pazifisten wird.
Kehren wir zuletzt an den Ausgangspunkt meines Aufsatzes zurück; kommen wir auf den Ukrainekrieg. Was leistet mein Argument gegen den?
Bevor ich darauf zu reden komme, ob es aus Sicht meines Argumentes gerechtfertigt sei, Waffen an die Ukraine zu liefern, will ich noch einmal auf den Punkt hinweisen, dass bereits vor Beginn des Krieges ein kardinaler Webfehler im zivilen Stand des Friedens vorhanden war; der nämlich, dass es Russland innenpolitisch möglich war, einen solchen Krieg überhaupt zu beginnen. Selbst wenn man das russische Parlament als demokratisch legitimiert ansähe — worüber ich mangels verlässlicher Informationen schweigen möchte — gingen dem Krieg keine konkreten demokratischen Prozesse voraus, die ihn legitimierten. Ich sage nicht, dass das ein genuin russisches Problem ist. Auch hierzulande sind die demokratischen Hürden in einen Krieg zu ziehen, gemessen an dem, was in Kriegen tatsächlich auf dem Spiel steht, lächerlich niedrig.
Ich möchte diesen Punkt wirklich stark machen, weil er mir wichtiger scheint, als alle Positionen zu Waffenlieferungen, bzw. zu Kriegen, die bereits im Gange sind. Der beste Pazifismus ist der, der den Krieg vor seinem Ausbruch vereitelt. Mein Argument ist zuvörderst ein Vernunftsargument; ein Argument, das auf Umstände abzielt, in denen das Für und Wider einer Sache zu großen Teilen durch Abwägen von Argumenten abgemacht werden kann; es ist ein Argument für Friedenszeiten.
Der Stand des zivilen Friedens hinsichtlich der Todesstrafe ist der, dass sie in 144 von 199 Staaten abgeschafft wurde. Gründe der Abschaffung gab es viele, es wurde mit der „Ehrfurcht vor dem Leben“ (u.a. Albert Schweizer) argumentiert; mit der Möglichkeit von Justizirrtümern und Justizmorden; mit der Möglichkeit, dass die Tötungsmethode versagt usw. Mein eigenes Argument würde lauten, dass die Befugnisse des Staates da enden, wo er das, was er schützt — hier: das Leben und die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger — im Namen des Schutzes aufhört zu schützen. Es ist ein immanenter Widerspruch. Die Ausnahme von der Regel lässt sich nicht mit dem Einhaltenwollen der Regel begründen. Selbst der sogenannte „finale Rettungsschuss“ (Notwehr bei der Polizei) sollte nicht von Vornherein gestattet, sondern eine Straftat sein. Man kann ja, wenn eine nachgehenden Untersuchung zu dem Schluss kommt, dass tatsächlich in Notwehr oder Abwehr einer grossen Gefahr geschossen wurde, den Schützen mit einer milden Strafe belegen. Es bliebe eine gänzlich andere Regelung; und eine eminent wichtige Einschränkung der Tötungvollmacht des Staates. Ähnliches gilt auch für Sterbehilfe in den Niederlanden; sie bleibt zunächst eine Straftat und der tötende Arzt muss in einer anfolgenden Untersuchung entlastet werden.
Ich bringe diese Beispiele für die Befugnisse von Staaten, Menschen zu Tode zu expedieren, weil der Krieg natürlich ebenfalls ein solches Befugnis darstellt. Der Stand des zivilen Friedens bemisst sich ganz zentral daran, wie ernst er den Schutz des Lebens tatsächlich nimmt. Ein Staat, der ein Kriegsrecht hat, kann kein vollständiger Rechtsstaat sein. Er ist am zentralsten Punkt seiner Aufgabe blind, bzw. unwillens, sie anzunehmen. An dem nämlich, seinen Bürgern einerseits Freiheit und andererseits Schutz zu garantieren. Wo wäre dies dringender und augenscheinlicher benötigt, als bei der Entscheidung eines Menschen, zu töten oder getötet zu werden, i.e. in den Krieg zu ziehen? Rechtssicherheit in diesen zentralen Belangen zu schaffen ist des Staates Pflicht; und ist überhaupt Grundlage und Rechtfertigung, seine Regeln zu akzeptieren. Eine Armee halte ich für solche Schutzbefugnisse nur erlaubt, so lange sie wie eine Polizei — oder eben freiwillige Feuerwehr — fungiert.
Mein Argument sieht auf den Krieg aus dem Blickwinkel des zivilisatorischen Fortschritts. Deswegen muss ich immer wieder und zuerst auf den Stand unserer Zivilgesellschaft verweisen. Ich wäre gern umstandslos auf die Ukraine gekommen. Aber ich kann nicht, ohne auf den ungenügenden, altertümlichem Stand des zivilen Friedens hinzuweisen, in dem immer noch das Kriegsrecht jenes Ungemach kodifiziert, das uns Pazifisten dann zwingt, Meinungen zum Krieg äussern zu müssen, wenn es bereits zu spät ist. Niemand sonst auf der Welt weist auf diesen dummen Fehler hin; wir Pazifisten tun es.
Ein Nachtrag noch über die Rechtfertigung von Verteidigungskriegen: Ich möchte die Binse wenigstens erwähnen, dass ein Staat kein Mensch ist (und auch kein anderes Lebewesen). Einem Menschen mag man das Recht auf Selbstverteidigung zugestehen; ich zumindest würde das. Daraus lässt sich nur eben kein Analogieschluss für Staaten verfertigen. Der Staat ist niemand, dem irgendwer sein Leben schuldete; im Gegenteil, es müssen die Befugnisse des Staates am Leben seiner Bürger enden. Der Staat ist lediglich eine Übereinkunft, nach welchen Regeln und mit Hilfe welcher Institutionen das Zusammenleben der Menschen organisiert werden soll. In ihm ist der Stand des zivilisatorischen Fortschritts konkretisiert und materiell ausgeführt; und dieser Stand ist sowieso Gegenstand ständiger Kämpfe und Veränderungen. Dem Staat eignet kein lebendiger Körper, der wie der Körper eines Menschen Recht auf Unversehrtheit beanspruchen könnte; und er lebt genauso wenig, wie ein Vertrag lebt. An ihm ist keine Freiheit, die über die Freiheit des Einzelnen hinaus ginge; und er ist auch nicht heilig oder sakrosankt. Wenn es Menschen einfällt, für einen Staat sterben oder töten zu wollen, dann mag das ihr demokratisches Recht sein. Es muss nur eben genauso demokratisches Recht sein, derlei Tötungs- und Sterbetätigkeiten fern bleiben zu wollen; und ich sehe also kein Argument, dass einen Staat mit einem Befugnis ausstattete, seine Bürger zum Krieg zu zwingen und sei es zu seiner Verteidigung.
Gut. Jetzt wir diese Dinge wiederholt haben, können wir den Aufsatz mit Behandlung der Frage schliessen, was mein Argument zum statthabenden Überfall Russlands auf die Ukraine zu sagen hat. Dass dem Überfall ein ungenügender Stand des zivilen Friedens in Russland voraus ging, hatten wir. Putin hätte das Recht nicht haben dürfen, seine Truppen in den Krieg zu schicken; ein Prozess, bei dem sowohl die Entscheidungsfindungen selbst undemokratisch verliefen; als auch die Durchführung, bei der es den Soldaten nicht gestattet war, sich dem Krieg zu verweigern. Sobald diese Prozesse in Gang gesetzt waren — also spätestens am 24. Februar 2022, aber eigentlich schon vorher — konnte die Verteidigung des ukrainischen Staatsgebietes ihrerseits nur durch einen zivilisatorischen Rückschritt innerhalb der Ukraine organisiert und durchgeführt werden. Das Kriegsrecht trat in Kraft, alle Männer über 25 mussten bei Einberufung, gleichgültig, ob sie wollen oder nicht, in den Krieg ziehen, sofern ihnen nicht gelang, schnell genug aus dem Land zu fliehen. Der Staat also — indem er den Krieg annahm und in einen Feldzug mit ungewissem Ausgang sich begab — verriet seine eigentlichen Zwecke und kann diesen Verrat nur wieder mit der Aussage legitimieren, er würde eine Ausnahme machen, um die Regel wieder herzustellen.
Ich stehe dazu — pragmatisch — wie folgt: Wenn die zivile Normalität eine kleine und kurze Störung erlitte — was „klein“ und „kurz“ bedeuten mögen, darüber kann man debattieren — gibt es nachvollziehbare Rechtfertigungen für diese Haltung. Wenn die „Störung“ aber unabsehbar lang andauert; und unabsehbare Schäden bewirken kann — spätestens dann ist der Krieg, auch der Verteidigungskrieg nicht mehr gerechtfertigt; und mit seiner Rechtfertigung fällt die für Waffenlieferungen.
Streng genommen erlaubt mein Argument die obige Ausnahme („kurz und klein“) nicht. Der Krieg kann nicht erreichen, was er vorgibt, erreichen zu wollen. Auch nicht die Wiederherstellung der Normalität nach seinem siegreichen Ende. Es liegt nicht in seiner Art. Aber ich bin bereit, mein Argument undogmatisch zu handhaben und Aufweichungen der oben skizzierten Art zuzulassen oder als diskussionswürdig einzustufen. Das Argument soll ja kein Dogma errichten, sondern einen Gesichtspunkt vorschlagen. Mein Anliegen ist nicht, die Unwürdigkeit und Entsetzlichkeit von Kriegen auch aus der Menschheitsperspektive zu bekräftigen, sondern die Augen dafür zu öffnen, dass das, was Menschen sich von Kriegen erhoffen; dass die Gründe, aus denen sie bereit sind, in Kriege zu ziehen oder Kriege fallweise zu unterstützen — dass diese Gründe in der Regel Irrtümer sind.
Letztlich wird die Menschheit den zivilisatorischen Fortschritt wie schon seit jeher mit und ohne Kriege ins Werk setzen. Vorausgesetzt, sie demoliert ihren Planeten nicht versehentlich vermittels solcher Kriege irreparabel. Ich extrapoliere das Fortschrittmachen aus der prinzipiellen Lernfähigkeit des Menschen. Wenn aber der Fortschritt ohnehin — wurschtelnd und schwankend zwar, mit Rückschlägen und ohne ein genaues Ziel zu kennen — aber endlich doch mit oder ohne Krieg sich ereignen wird, dann können wir den Krieg eigentlich auch ganz unterlassen. Ich schlage lediglich vor, dass wir uns ohne die sinnlosen und beschämenden kriegerischen Umwegigkeiten aufs weitere Einrichten des Fortschritts stürzen.
Kein Staat ist es wert
(Text, Musik, Gesang & Instrumente: Daniel H. Rapoport)
Kein Staat ist es wert, dass einer für ihn tötet,
Und kein Staat ist es wert, dass einer für ihn stirbt.
Keines Staates Recht, sei’s noch so schief gelötet,
Ist, dass zum Krieg er nötigt, oder auch nur dafür wirbt.
Wofür lohnt zu leben? Und wofür lohnt zu sterben?
Und wofür lohnt, dass man als Mörder einmal im Geschichtsbuch steht?
Kein Staat hat das Recht, Dich derart zu verderben.
Besonders keiner, der’s für legitim hält, dass er Dir ans Leben geht.
Was soll das denn für’n Staat sein, der’s Töten Dir befehl’n darf?
Wozu den noch erhalten, der Dich nicht erhält?
Was soll’s, wenn man zwar ne Partei, doch nicht zu leben wähl’n darf?
Und wenn das Allerwichtigste zuerst zum Opfer fällt?
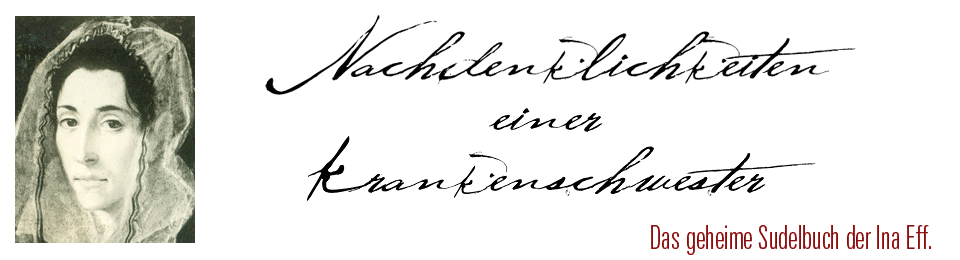
Hallo InaEff,
danke für diesen bedenkenswerten Beitrag.
Ich finde aber dass der Pazifismus um gegenwärtige Kriege wirklich zurückweisen zu können zwei wesentliche Einwände gegen deine Argumentation entkräften können muss. Auf den ersten kommst du selbst zu sprechen: Das Problem der Bürgerkriege.
Es ist zugegeben, dass in Bürgerkriegen nicht über Grenzen gestritten wird sondern um die Art wie die Gesellschaft eingerichtet wird. In der Jetztzeit beobachten wir die Tendenz, dass nahezu jeder Krieg als eine Art Bürgerkrieg aufgefasst wird, insbesondere von denen die sie Führen und dass nicht um den Verlauf von Grenzen gekämpft wird, die sich, wie du schon erwähntest, ohnehin kaum noch verschieben lassen, sondern darum wie das internationale System eingerichtet sein soll.
In Afghanistan, im Irak, in Libyen und in Syrien fiel man nicht ein um zu erobern sondern um den Charakter der jeweiligen Regierungen/Machtstrukturen zu ändern und auch der Krieg in der Ukraine wird in erster Linie geführt um die Rechtsauffassung der jeweiligen Kriegsparteien bezüglich des Völkerrechtes durchzusetzen. Zumindest wird dieser Krieg so gerechtfertigt und die westlichen Kriegsbefürworter hoffen, dass durch ein Gewinnen einer Reihe solcher Kriege ein stabiles internationales System entstehen kann. Diese Auffassung erschwert das Wiederherstellen des Friedens im Konfliktfall ungemein, da Recht strenggenommen keine Kompromisse zulassen kann und ist daher sehr gefährlich.
Der zweite Einwand ist weniger aktuell, aber er könnte es eventuell wieder werden: Bei diesem geht es um den Marxismus. Der Marxismus streitet für das partikluare Interesse der Arbeiterklasse und behauptet, dass das partikulare Interesse der Arbeiterklasse in eins fällt mit einem universalistischen Menschheitsinteresse. Die Begründungen dafür sollten dir geläufig sein und ich gehe davon aus, dass du sie auch plausibel findest. Wenn aber eine Situation existiert, wo das Partikularinteresse einer Gruppe zugleich universalistisch ist sind wieder eine große Reihe von Kriegsrechtfertigungen möglich, sowohl bei Bürgerkriegen als auch bei internationalen Konflikten (Sozialismus in einem Land). Du könntest einwenden, dass der Siegeszug der Arbeiterklasse sich ebenfalls vor allem im Zivilen vollzieht, aber wie auch bei den proamerikanischen Völkerrechtlern kann auch hier der Krieg im Zweifelsfall als ein relevanter Teil des sich höherwurschtelns der Menschheit aufgefasst werden.