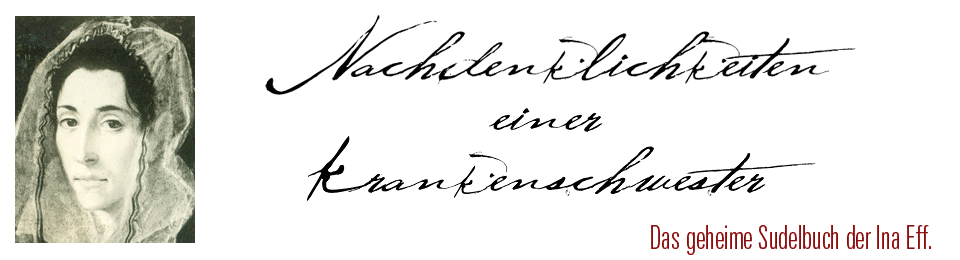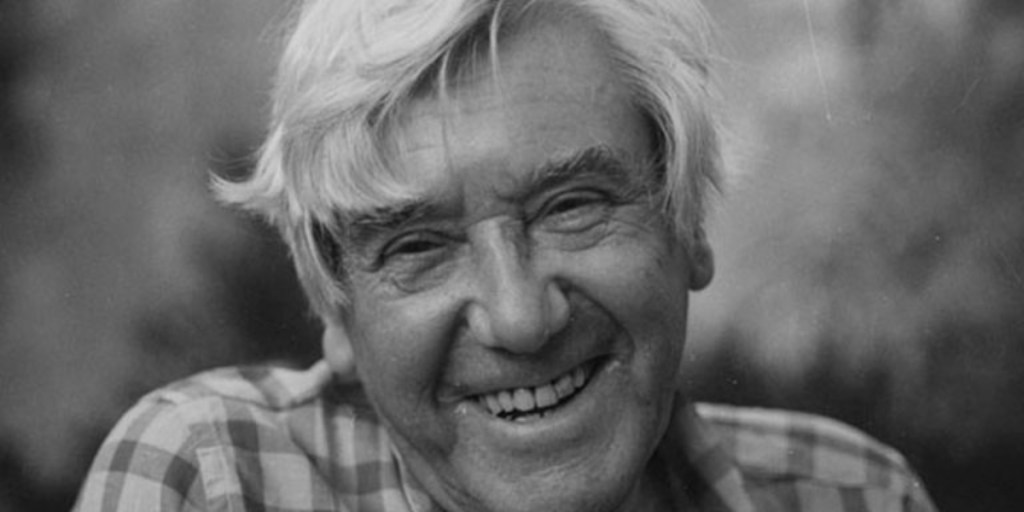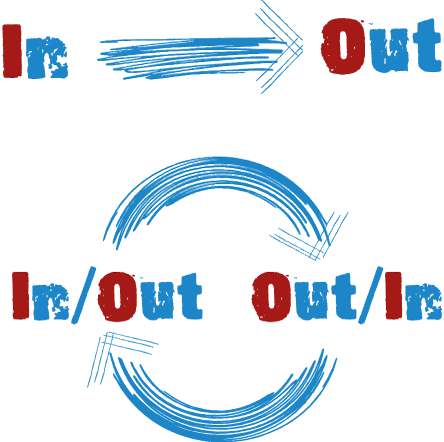Synopsis
Zynismus, Feigheit, zumindest aber Weltfremdheit wird dem Pazifismus seit jeher vorgeworfen und der Grimm, mit dem ihm derlei Vorwürfe gemacht werden, schwillt über jedes Maß, sobald ein Krieg erst ausgebrochen ist. Man kennt’s. Andererseits: Sieht man auf die Zwecke, mit denen Kriege begonnen werden, scheint der Pazifismus einen erstaunlichen Siegeszug hingelegt zu haben; ganz weltfremd kann er nicht sein: War es dereinst, zu Zeiten von Sumer oder Ägypten, gebräuchlich, Raub und Brandschatz als Ziel und Zweck von Kriegen anzugeben, wurden sie später nur noch aus religiösen, dann aus völkischen und kulturellen Gründen angezettelt. Heute werden Kriege ausschliesslich aus humanistischen Gründen geführt, etwa um Schlimmeres zu vermeiden, um Menschen zu befreien, Kriege zu beenden usw. Wie soll man das Hochschrauben der Kriegsgründe in immer menschenfreundlichere und barmherzigere Sphären deuten, wenn nicht als Siegeszug des Gedankens, dass Kriege eigentlich abscheulich seien, ihr Führen ein Verbrechen und schon die Absicht zu ächten?
Der vorliegende Aufsatz widmet sich der Zerstörung dieses letzten noch übrigen, des humanistischen Kriegsgrundes. Was der Humanismus will, soll demonstriert werden, kann der Krieg nicht leisten. Nicht, weil der Krieg per Definition die Anwendung inhumaner Gewalt bedeutet; derlei Gründe sind schon vielfach ausgeführt und auch von Kriegsbefürwortern nicht bestritten worden. Kriegsbefürworter geben die Gewalt ja zu. Sie wollen eigentlich keine Kriege. Niemand will Kriege. Ausser manchmal. Die Kriegsbefürworter sehen Kriege als bedauerliche, aber notwtwendige Ausnahme, um zur Regel zurückkehren zu können; als leider unvermeidliche Roßkur, um das Übel auszutreiben; kurz, als rabiates, aber zweckrichtiges Mittel, um den Humanismus schnellstmöglich wieder herzustellen.
Die Idee des Ausnahmemachens vom Humanismus, um zu ihm zurückkehren zu können, wird hier überprüft. Mein Argument geht von einem Humanismus-Begriff aus, den ich aus der Geschichtsauffassung Hegels extrapoliere. Aus der folgt unmittelbar, dass das Führen von Kriegen — insbesondere jenen, die das Verschieben von Staatsgrenzen bezwecken — nie etwas von dem bewegt hat oder auch prinzipiell bewegen könnte, was Humanismus und zivilisatorischer Fortschritt meinen. In seiner praktischen Konsequenz zielt das Argument eher auf die Beschaffenheit des zivilen Friedens, insbesondere auf die universelle Abschaffung des Kriegsrechtes, denn auf Handlungsoptionen nach dem Ausbruch von Kriegen. Trotzdem ist der in diesem Aufsatz entwickelte Standpunkt geeignet, nachzuweisen, dass die meisten Kriege, die aus humanistischen Gründen geführt wurden, in Wahrheit furchtbare Irrtümer waren, die ihr Ziel nicht erreichten und nie erreichen konnten. Auch das Argument, der Ausgang des zweiten Weltkriegs liefere eine empirische Rechtfertigung für das Führen von Kriegen zu humanistischen Zwecken, wird kritisiert. Am Ende behandelt der Aufsatz noch die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine.
Intro
Krieg ist fast immer. Seit aber Russland die Ukraine überfallen hat, ist er nicht nur gegenwärtig, sondern auch gewärtig. Seit dieser Krieg anhob, geht es auch hierzulande nurmehr um Waffenlieferungen, um Flüchtlingshilfe, um Aufrüstung, Raketenstationierungen und Wehrpflicht, um Gaspreise und Inflation; um Atomdrohungen, Sanktionen und um aussenpolitische Bündnisse und Abhängigkeiten. Die Kriegstrommel gibt den Rhythmus vor und ist das Hauptinstrument der Jetztzeit. Sie übertönt Corona, Klimadebatten, Cancel Culture und sogar den Radau um die Wiederkehr des Faschismus. Das Ganze ist begleitet von massiven ideologischen Kämpfen um Deutungshoheiten entlang der verschiedenen Linien des Konfliktes; hauptsächlich natürlich um die Ursachen und Vorgeschichten des Krieges, mit anderen Worten, um die Schuld.
Ein eher mittelbeachteter Nebenschauplatz dieser ideologischen Scharmützel betrifft den Pazifismus. Im Zuge des Kampfgetümmels hat der Pazifismus (naturgemäß) eine besonders feindselige und abschätzige Behandlung erfahren. Über Nacht entstand das Kampfwort vom „Lumpenpazifisten“ und Bertha von Suttners ehrbares „Die Waffen nieder!“ war plötzlich verschrieen als Losung der Niedertracht und des Verweigerns von Mitgefühl und Solidarität mit den Überfallenen, Bedrängten und Geschundenen.
Weiterlesen