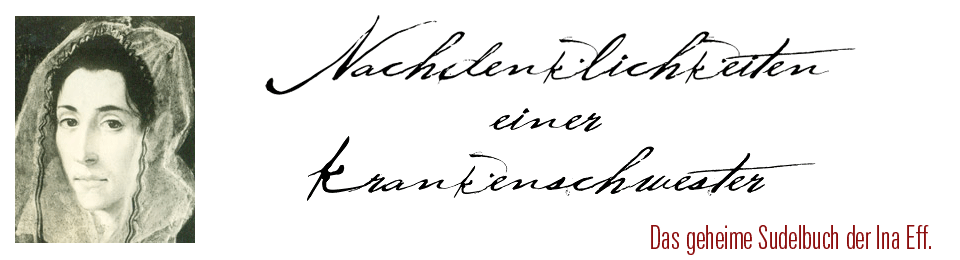Mein Freund und Hirnteiler Felix Bartels fragte mich jüngst anläßlich des Lobster-Awards, ob ästhetische Urteile objektivierbar wären. “Nein”, antwortete ich ohne Zögern.
Noch indem ich dieses „Nein“ aussprach, war der Drang in mir entstanden, es auch zu begründen. Deswegen setzte ich sogleich hinzu, dass ästhetische Urteile allenfalls größere Gültigkeit erreichen könnten, indem sich ästhetischer Genuß und rationale Durchdringung eines Werkes wechselseitig erhöhten. Gültigkeit wiederum äussere sich als Nachvollziehbarkeit, Wohlstrukturiertheit und Komplexität einer Urteilsbegründung. — Etwas an dieser aus der Hüfte geschossenen Begründung fühlte sich unvollständig, wo nicht falsch an. Nun weiss ich, was es war. Ich bleibe beim “Nein”, aber inbetreff der Gültigkeit will ich im Folgenden einiges berichtigen und erweitern.
Drei Argumente plane ich vorzutragen:
(1) Erstens, die Auffassung von ästhetischer Wirkung kritsierend, die der Frage zugrunde liegt.
(2) Zweitens, die gesellschaftliche Praxis betonend, in die jegliche Kunst betten muss.
(3) Drittens, über Gültigkeit und den Drang handelnd, andere vom eigenen ästhetischen Urteil zu überzeugen.
Erstens. Ad Kunstauffassung.
Die Frage nach der Objektivierbarkeit ästhetischer Urteile erkundigt sich nicht allein danach, ob künstlerischen Gegenständen Eigenschaften zugesprochen werden könnten, die messbar sind, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit eines Teilchens – Eigenschaften mithin, in denen ihr ästhetischer Wert sich ausdrückt – sondern auch danach, wie ästhetischer Wert überhaupt zustande kommt?
Man kann darauf antworten, dass der ästhetsische Wert sich im Tauschwert realisiere, den ein Kunstwerk erzielt. Das wäre in etwa die Auffassung des Kunstmarktes. Diese Auffassung wurde vielfach kritisiert, weswegen ich sie einmal zurück stellen möchte; ich komme aber weiter unten auf sie zu reden.
Hier will ich eine einfache Idee des Zustandekommens ästhetischer Werte geben und vor allem deren Konsequenzen ausführen. Ich meine, der ästhetische Wert eines Werkes realisiert sich in der Wirkung, die ein Werk im Betrachter – oder Hörer, Leser etc – im Kunstgeniesser also, auslöst.
Die Bestimmung eines Werkes ist deshalb nicht, andere Werke zu übertreffen, sondern vermittels seines Genusses Wirkung zu entfachen. Meine Behauptung lautet nun, dass, so man diese Idee vom Zustandekommen ästhetischer Wirkung teilt, die Frage nach der Objektivierbarkeit ästhetischen Urteilens ganz falsch ist; dass sie sich gar nicht stellt.
Am einfachsten lässt sich diese Folgerung illustrieren, wenn wir uns erinnern, wie unser eigenes ästhetisches Urteil sich im Verlauf unseres Lebens geändert hat. Als Kinder oder Jugendliche haben wir andere Musik wertgeschätzt, andere Bilder bewundert, in anderen Romanen geschwelgt, als wir es als Erwachsene tun; und eigentlich würde ich ungern der Hoffnung entsagen, dass wir das ganze Leben fortfahren, hinzu zu lernen.
Daraus abzuleiten, unser Urteil wäre als Kind falscher, denn als Erwachsener, scheint mir vorschnell und vor allem dem Bestreben geschuldet, die Gültigkeit und Überlegenheit unserer gegenwärtigen, vielleicht auch mühsam erarbeiteten Urteile vor jenen kindlichen zu wahren, nur weil die einfacher zu haben waren. Dabei liesse sich leicht das Gegenteil vertreten: Es ist durchaus möglich, dass wir als Kinder oder Jugendliche grössere Wirkung eines Werkes empfunden haben. Mit welchem Recht bestritten wir nun dieser Wirkung ihren ästhetischen Rang? Und, wesentlicher noch, müssen wir nicht in unseren kindlichen Urteilen die Knospe erblicken, aus dem sich unser heutiges Schätzungs- und Genussvermögen entfaltet hat – überhaupt nur entfalten konnte? Ist nicht dieses Voraussetzung für jenes? Und hat nicht die Kunst unserer Kindheit selbst, durch den Umgang mit ihr, diese Entfaltung nur bewirken können? Was also sollen Rangfolgen von Urteilen überhaupt?
Man erkennt, worauf ich hinaus will. Kunstgenuss und das Aneignen von Erfahrung im Kunstgeniessen zielen überhaupt nicht auf gesteigerte Objektivität unserer Urteile. — Objektivität ist immer eine Flucht fort vom Subjekt. Das ist ihr Sinn: Unabhängikeit vom Subjekt und seinen Meinungen und seiner Fallibilität. Kunst nun, indem sie ästhetische Wirkung ausübt, will das genaue Gegenteil dieser Bewegung. Kunst, und die Auseinandersetzung mit ihr, verlangt nach Entfaltung des Individuums; verlangt nach Entfaltung und bewirkt sie überhaupt. Je mehr Kunst das Subjekt kennt, versteht und geniesst, desto mehr wird es überhaupt Individuum. Es bildet immer neue Facetten des Kunstverständnisses, Blickwinkel, aus denen die Kunst ins Leben spielt, Gesichtspunkte, unter denen Kunst sich auffassen und geniessen lässt; Verständnis für komplexere Formen und ihre Angemessenheit an einen Inhalt. Kunst ist die Bewegung hin zum Individuum.
Nicht schafft Kunst das Allgemeine; sie schafft, im Gegenteil, das Besondere. Alle Kunstgeniesser erkennen einander; und sie erkennen einander daran, dass ihre Urteile sich unterscheiden! Es ist ja Eigenheit gerade des ungebildeten Kunsturteils, gleichförmig zu sein. (Der Aufdruck “Bestseller” gilt dem Kenner als Warnung. Manchmal freilich ist er trotzdem geniessbar, vorausgesetzt, man schreckt ihn kurz mit kochendem Wasser ab.)
Es liegt daran, dass die ästhetische Wirkung eines Werkes nie ohne das Zutun des Individumms stattfinden könnte. Die Wirkung eines Kunstwerkes entsteht durch die private, ganz eigene Inbezugsetzung des Kunstgeniessenden zum Werk. Anders ist Kunstwirkung – und mit ihr, ästhetisches Urteilen – überhaupt nicht zu haben.
Es geht dabei nicht nur um das Auffassen einer im Werk verschlüsselten Information (wie manche Kunsttheoretiker meinten), sondern, noch umfassender, um eine Art der Selbstwerdung. Zum Selbst gehören einmal unsere ästhetischen Vorlieben und Urteile; sie können sich nicht anders bilden, als im Umgang mit schönen und hässlichen Dingen. Unterschiede der Schönheit sind Unterschiede in unserer Seele, oder, wem das altschöne Wort “Seele” nicht behagt, dem mögen sie als kunstumgangsgebildete Beschaffenheit unseres Selbst gelten. Mithin ist ein ästhetisches Urteil nicht Audruck einer Sache ausser uns – Eigenschaft eines Kunstwerkes etwa – sondern Ausdruck unserer Seelenbildung. Dies ist mein hauptsächlicher Gedanke, und wer keine Lust verspürt, Addenden zu studieren, darf die Lektüre an dieser Stelle getrost beenden. Der Rest dieser Ausführung ist nämlich im Grunde nur noch Entfaltung des Gesagten.
Den Weiterlesenden: Sobald einmal begriffen ist, daß Schönheit nurmehr ein Unterscheidungsvermögen ist, beginnt die Frage nach der Objektivierbarkeit ästhetischen Urteilens ganz seltsam zu scheinen. Im Grunde lautet diese Frage nämlich: Wie objektiv ist das Subjekt? So dialektisch die Frage auch klingt, so blödsinnig ist sie in dieser Formulierung und diesem Zusammenhang. Wir scheiden das Subjektive ja vom Objektiven, um das zu trennen, an dessen Existenz wir tätig mitwirken müssen von dem, das unserer Mitwirkung überhoben sein soll. Wie weit diese Scheidung trägt, mag dahin stehen und kann meinetwegen Anstoss zu einem philsophischen Betracht sein. Aber danach fragt die Objektivierbarkeit ästhetischen Urteilens nicht; sie erkundigt sich nur, wohin – Scheidung des Subjektiven vom Objektiven bereits voraus gesetzt – wohin dann ästhetische Urteile ordneten?
Weiterlesen →