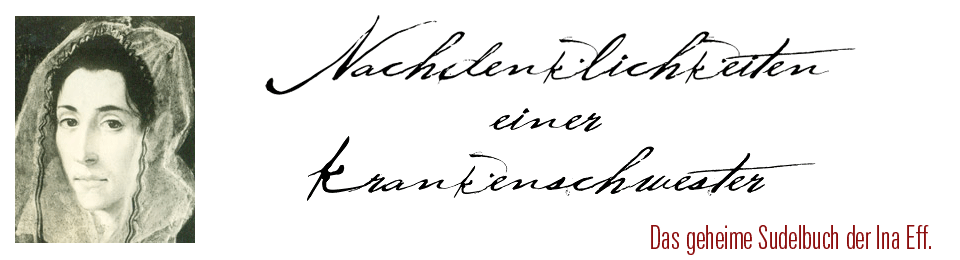Vortrag vor der Rapoport-Gesellschaft
https://www.rapoport-gesellschaft.org/
I Einleitung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Frage wurde mir vorgelegt, ob Profitstreben in den Lebenswissenschaften eine Rolle spielt. Die Frage kann ich mit einem klaren Jein beantworten.
Das „Nein“ im Jein ergibt sich zunächst aus der einfachen Tatsache, dass die Forschung hierzulande wesentlich an den Universitäten und in den Laboren der großen Forschungsgesellschaften besorgt wird. Die werden ihrerseits größtenteils aus allgemein erhobenen Steuern finanziert und können ihre Ergebnisse also in der Regel nicht für einen Gewinn verkaufen.
Der Anteil der Forschungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt liegt derzeit bei über 3% und ist damit in den letzten 20 Jahren um fast 30% gewachsen. Das klänge sehr komfortabel, wären nicht im gleichen Zeitraum die Zahl der Forschenden mehr als doppelt so schnell angewachsen — nämlich um 67%[1]. Damit steht pro Forscher etwa 17% weniger Forschungsbudget zur Verfügung als noch vor 20 Jahren; darüber wird zu reden sein[2].
Zunächst aber zu dem „Ja“ im Jein. Es ergibt sich aus der generellen Motivation, aus der Regierungen überhaupt bereit sind, substantielle Summen für die Forschung auszugeben: Weil der allgemeine Glaube herrscht, dass das Wachstum einer Nationalwirtschaft — und damit Wohlstand und sozialer Frieden — letztlich fast ausschliesslich an Innovationen hängt. Dass also eine Nation, die im Wettlauf der Nationalwirtschaften bestehen will, unbedingt in Bildung und Forschung investieren müsse.
Die Idee, dass Innovation der tiefere Grund für jedwedes Wirtschaftswachstum sei, geht auf den österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter zurück, der praktisch ein Zeitgenosse meiner Großeltern war. Hier ist keine Zeit, über die Schumpeterschen Ideen zu handeln; deshalb nur soviel, dass sie inzwischen zum Allgemeinplatz fast jeder ökonomischen Denkrichtung geworden sind; und implizit auch Bestandteil der sozialistischen Ökonomie waren. Im Sozialismus allerdings ging man davon aus, das Wachstum in gesteigerten Gebrauchswert umzusetzen, anstatt in gesteigerten Wert, bzw. Profit. Grundlage des Wachstums aber blieben Innovation und Wissenschaft.
Wie dem auch sei: Nimmt man den Schumpter ernst, dann wird im herrschenden Kapitalismus also durchaus einen Profit aus der Forschung erwartet. Nur eben ein mittelbarer anstatt eines unmittelbaren.
Der erwartete mittelbare Effekt ist der, dass die Wissenschaft als System von Wissensproduktion und Wissen — als Ganzes also — fortschreitet; dass dieser Zuwachs an Wissen in der angewandten Forschung in Technologien umgemünzt werden kann; dass diese Technologien zu neuen Märkten und effizienterer Produktion führen; dass dadurch ein Profit entsteht; und dass dieser Profit endlich wieder zu einem Teil in die Wissenschaft re-investiert wird. So ergäbe sich in einer idealen Welt ein stabiles, selbsterhaltendes System, dass sich wie Münchhausen am eigenen Schopf gleichzeitig aus dem Morast der sozialen Prekarität und der Unwissenheit zu ziehen vermag.
An dieser groben Idee ist viel Schönes; aber in der Realität funktioniert sie dann eher schlecht als recht. Es wird wohl etwas mit der Idee von Wissenschaft als Motor im Rennen der Nationalwirtschaften zusammen hängen. Die Probleme ergeben sich dabei — so wie der erhoffte Nutzen — nicht unmittelbar, sondern mittelbar.
II Wo die Wissenschaft krankt.
Damit ich nicht mißbegriffen werde: Es ist wirklich viel Schönes an der Idee. Es klingt sarkastischer, als gemeint. Ich bin zwar weder vollends von Schumpeter überzeugt, noch von der Notwendigkeit fortgesetzten wirtschaftlichen Wachstums; aber ich bin von der Notwendigkeit und Unausweichlichkeit des menschlichen Dranges nach Erkenntnis überzeugt; und davon, dass aus diesem Drang stets neue Technologien und Innovationen erwachsen werden.
Dennoch muss ich durchaus schlechte Nachricht geben. Die Wissenschaft ächzt nicht etwa bloß an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Sie ist weit über diese Grenzen hinaus; sie ist, bei Tage besehen, in den meisten ihrer Organe und Aufgaben dysfunktional. Sie tut nur noch so, sie erweckt den Anschein als ob. Sie ist im Grunde ein Zombie, eine lebende Leiche. Vieles an ihr stinkt bereits.
Es ist nicht möglich, gleich alle großen Problemfelder der Wissenschaft in diesem Vortrag zu behandeln. Ich will mich auf diejenigen fokussieren, die direkt mit dem Obengesagten zusammenhängen, also mit der Erwartung sie möge Zurüstung und Ertüchtigung sein im Wettkampf der Nationalökonomien.
Ich will aber wenigstens kurz erwähnen, dass es daneben auch Probleme gibt, die die inneren Mechanismen der Wissenschaft betreffen: Das Problem etwa der weltweit enorm angestiegenen Anzahl von Wissenschaftlern und wisssenschaftlicher Publikationen; dann das Problem der Bewertung von Wissenschaftlern anhand bibliographischer Indikatoren, wie dem Impactfaktor; die Probleme der akademischen Selbstverwaltung, die zu einer hypertrophierten Bürokratie geführt haben und den Wissenschafts- und Lehrbetrieb in weiten Teilen zum Stillstand bringen.
In die selbe Kerbe unfassbar gesteigerter Ineffizienz schlägt die typische Produktivitätskurve eines durchschnittlichen Wissenschaftlers: Erst studiert er fünf Jahre, dann promoviert er drei bis fünf Jahre: Macht acht bis zehn Jahre Lehrzeit. Nach der Doktorarbeit kommt die erste Postdoc-Stelle, die in der Regel drei Jahre dauert, dann die zweite für weitere drei Jahre und dann geht es schon wieder ab, Richtung leitende Stelle; man wird Abteilungsleiterin oder Professorin und beschäftigt sich mit Geldbeschaffung, Gremiensitzungen, Einstellungen, Gutachten, Verwaltungsvorgängen und so fort. Ein normaler Wissenschaftler ist demnach vielleicht sechs bis acht Jahre seiner Laufbahn wirklich als Forscher eigenständig produktiv.
Das sind, kursorisch, ein paar der hausgemachten Probleme. Jedes ist für sich bereits riesig. Aber selbst zusammen genommen machen sie nur einen Bruchteil des multiplen Versagens aus, an dem die Wissenschaft heutzutage krankt.
Hier kommen fünf darüber hinaus gehenden Mängel, die direkt mit dem lieben Geld, das heisst, mit dem Imperativ zu anwendbarem wissenschaftlichen Erfolg und letztlich Profit zusammenhängen. Ihre Auswahl ist dennoch längst nicht erschöpfend.
Erstens: Falsche Erwartungen an die Wissenschaft, falsches Verständnis von ihr. Ideologie der Nützlichkeit.
Ich beginne mit einer subtilen Unterscheidung. Meine Mutter hat mir einen Merksatz mitgegeben; er lautet: „Was man weiß ist gut.“. Sie hatte ihn von ihrem Vater, der Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten war und auch selbst forschte. Ich möchte seinen Merksatz kontrastieren mit dem fast gleichlautenden, aber gänzlich anderen „Was man weiß ist nützlich“.
Die Unterscheidung ist ähnlich der, die Aristoteles in seinen Schriften zur Ethik macht; der nämlich zwischen Praxis und Poiesis. Poiesis meint Handeln im Verfolg eines Zieles: Beispielsweise Hausbauen oder etwas verkaufen, um einen Profit zu machen. Praxis meint dagegen, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Instrumentenspielen zum Beispiel — oder lernen oder spielen.
Wir benötigen die Unterscheidung, um den Punkt zu verdeutlichen, dass Wissenschaft idealerweise eine Praxis sein sollte und keine Poiesis; dass ein Wissenschaftler eher spielt, als wirtschaftet; dass Wissen ein Wert an sich ist, und nicht nur ein Werkzeug, nicht nur, neudeutsch: Know-How.
Die Unterscheidung ist keinesfalls absolut, derart, dass Wissenschaft nur das eine oder das andere sein könne oder müsse. Stattdess handelt es sich um eine Frage der Auffassung, des grundlegenden Verständnisses. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass Wissenschaft eine Praxis im aristotelischen Sinne ist; und das Wissen, das sie schafft, ein Wert an sich.
Das heisst, es muss auf fundamentale Weise egal und unwichtig sein, ob eine Frage, die eine Wissenschaftlerin zu klären trachtet, sich in den Augen anderer als nützlich oder unnütz erweist. Es interessiert sie. Das reicht. Das muss reichen.
Die verderbliche Wirkung der Auffassung von Wissenschaft als Poiesis anstatt Praxis lässt sich bereits an dem harmlosen Symptom erkennen, dass man im Grunde keine wissenschaftliche Publikation mehr findet, in deren Einleitung sich nicht lesen liesse, wozu die dargestellten Ergebnisse eines Tages gut sein werden und welche künftigen Anwendungen und Durchbrüche sie ermöglichten. Letztlich permanente Rechtfertigungen, eine bestimmte Forschung durchgeführt und dafür Steuergelder verausgabt zu haben.
Schwieriger, als dieses ständige sich-entschuldigen wird es, wenn man sich die wirklichen Konsequenzen der poietischen Denkart vor Augen führt: Ein junger Mann, der zu den Galapagos-Inseln reist und die Gestalt der dort lebenden Finken studiert, konnte unmöglich ahnen, dass er aus diesen Beobachtungen eine umfassende Theorie über die Entstehung der Arten ableiten würde und im Übrigen ein Forschungsprogramm in die Welt wuchtete, das bis heute fruchtbar ist und längst nicht zur Neige ausgeforscht. Wie wollte man den Nutzen dieser Fahrt zu den Galapagos-Inseln bemessen, geschweige denn voraussehen?
Meine These dazu lautet, dass praktisch alle fundamentalen und großen Theorien und Entdeckungen das Resultat von extrem spezifischen Fragestellungen sind, deren Beantwortung sich erst im Nachhinein als verallgemeinerbar und manchmal auch nützlich herausstellte. Man sieht diesen spleenigen Fragen die in ihnen eingeschlossenen Möglichkeiten und ihren potentiellen Nutzen nie an. Im Übrigen gilt die Umkehrung natürlich nicht: Nicht jede spleenige Frage führt zu wissenschaftlichen Umwälzungen. Die wenigsten Fragen tun das. Was noch mehr dagegen spricht, irgendeinen Nutzen aus wissenschaftlichen Fragen herausdeuten zu wollen. Es geht nicht.
Das hat natürlich eine Konsequenz für die Mittelverteilung in der Wissenschaft. Im Wesentlichen bedeutet es, dass man den Fortschritt nicht zwingen kann. Man kann ihn ermöglichen. Und dann muss man warten. — Wartenkönnen ist eine im Kapitalismus sehr abhanden gekommene Tugend.
Zweitens: Steuerbarkeit von Wissenschaft durch Geld. Die Drittmittelkatastrophe.
Das führt uns direkt zu der Frage, ob Geld — Forschungsmittel — ein geeignetes Instrument zur Steuerung der Wissenschaft sei.
Die Regierungen der Industrienationen geben einen ständig wachsenden Teil des Forschungsbudgets nicht mehr direkt an die Forschenden; man muss sich um dieses Geld mit Anträgen bewerben. Das sind buchdicke Dokumente, deren Abfassen enorme Zeit verschlingt und in denen man genau darstellen muss, welche Versuche man durchzuführen beabsichtigt und was dabei idealerweise herauskommen wird. Schon die Anlage ist unsinnig und verkennt, dass Forschung immer ein Umgang mit dem Unbekannten ist. In Deutschland läuft dieses System unter dem Namen „Drittmittel“.
Der Drittmittelanteil am Gesamtetat der Hochschulen liegt bei derzeit 20%; das Gesamtetat beinhaltet aber auch die Verwaltung, Betriebskosten, Baumaßnahmen usw. — so dass die eigentliche Forschung zu einem erheblich höheren Anteil von Drittmitteln abhängig ist. Ich schätze auf knapp die Hälfte.
Daraus folgt, dass das Drittmittelsystem de facto die Abschaffung der in Artikel 5 des Grundgesetzes garantierten Freiheit der Wissenschaft bedeutet. Im Grunde kann ich nicht forschen, ohne Drittmittel einzuwerben. Ohne also, dass dem Staat mein Forschungsvorhaben frommt.
Sodann bringt das Drittmittelsystem ein gigantisches und ständig wachsendes Gutachter-System in die Welt; das BMBF und die DFG müssen tausende, wenn nicht zehntausende Leute dafür bezahlen, dass sie Anträge durchlesen, bewerten, Projekte kontrollieren und so fort. Alles Leute, die ihrerseits Geld kosten, das man leichterdings für die Forschung selbst verwenden könnte.
Damit immer noch nicht genug: Das Ganze säht natürlich Missgunst, Neid und Mißtrauen unter den Wissenschaftlern. Der Betrieb, der eigentlich auf Kooperation und Austausch angewiesen ist, zerfällt zusehends in kleine Beutegemeinschaften, die einander schiefblickend und verschlossen begegnen.
Jedes Anreizsystem hat zur Folge, dass sich das System in die dadurch geschaffenen Strukturen einschmiegt. Die Wissenschaftler passen sich natürlich an. Sie wollen schon gar nichts mehr erforschen oder herausfinden. Sie wollen nur noch Drittmittel gewinnen. Das reicht ihnen schon. Ich habe sehr viel öfter erlebt, dass ein erfolgreich eingeworbenes Projekt gefeiert wurde, als irgendein in ihm entstandenes Forschungs-Resultat. Das ist das Mindset moderner Wissenschaftler. Es ist das Resultat verfehlter Steuerungsabsichten über den Weg zweckgebundener Gelder.
Was aber ist mit der Qualität der Forschung? Litte sie nicht, würde das Geld einfach so, ohne Prüfung verteilt? Das Argument wird immer wieder gebracht. Auch dazu gibt es natürlich Zahlen. Im Jahr 2016 zB publizierten Fang und Kollegen eine Studie in der Fachzeitschrift elife [3]. Sie untersuchten für mehr als 100.000 bewilligte Forschungsprojekte den Zusammenhang zwischen Bewertung des Antrags und den resultierenden Publikationen. Das Ergebnis (wenn man an bibliographische Metriken glaubt) war, dass die Vorhaben, die im Bewilligungsverfahren zu den besten 20% eingeschätzt wurden, am Ende kaum 1% besser waren, als zufällig gewählte Veröffentlichungen. Ein Prozent besser als der Zufall! So gewaltig darf man sich die Effizienz der gesteuerten Geldvergabe in der Wissenschaft denken; das ist der reale Effekt der Exzellenz— und Qualitätssicherung via Drittmittelvergabe.
Und doch ist das wahre Resultat der ausgeuferten Drittmittel noch viel verheerender:
Drittens: Druck auf den Kessel geben. Leistungsprinzip in der Wissenschaft.
Das ist meines Erachtens der schlimmste Aspekt: „Druck auf den Kessel“ geben, das heisst, den Wissenschaftlern „Dampf zu machen“, damit sie produktiver würden. In der Wissenschaft macht man das zum einen, indem man Haushaltsstellen befristet; und zum anderen ergibt es sich daraus, dass viele Gehälter aus Drittmitteln gezahlt werden. Jedes Drittmittelprojekt hat eine Laufzeit — in der Regel zwischen einem und drei Jahren — woraus folgt, dass auch die Stellen der auf diesen Projekten arbeitenden Wissenschaftler automatisch befristet sind. Sie müssen innerhalb dieser Projektlaufzeit liefern.
Zwischen Darwins Fahrt mit der Beagle und der Veröffentlichung von „Über die Entstehung der Arten“ lagen etwa 20 Jahre. Keiner Wissenschaftlerin würde heute eine derartige Zeitspanne des Überlegens eingeräumt. Wer nicht innerhalb von drei, maximal vier Jahren publiziert, fliegt raus.
Die Folge liegt auf der Hand: Fast alle Wissenschaftlerinnen forschen risikoavers. Niemand traut sich, oder ist überhaupt in der Lage, ein langfristiges, ungewisses Forschungsziel ins Auge zu fassen. Stattdessen ist es am besten, wenn man eine Meß- oder Präparations-Methode beherrscht — sowas wie hochauflösende Elektronenmikrsokopie oder Halbleiterkristalle herstellen — dann kann man mit hoher Sicherheit konstant publizieren. Ich habe nichts gegen solche Forschung; sie ist notwendig, um die riskante — oft genug deswegen auch fruchtlose — Forschung zu ermöglichen. Es müssen nur eben auch überhaupt Möglichkeiten für solche Leute bestehen bleiben; sonst kommt die Wissenschaft zum Stillstand. Momentan steht sie.
So ein Stillstand äussert sich nicht darin, dass die Wissenschaftlerinnen nun gar nichts mehr herausfinden oder publizieren. Im Gegenteil. Um die Flaute zu vertuschen, publizieren sie mehr und jazzen jedes noch so kleine Ergebnis zu einem wissenschaftlichen Durchbruch hoch. Stillstand äußert sich als hektischer Betrieb; darin, dass Sensationen und Moden an die Stelle von Diskussion und Nachdenklichkeit getreten sind.
Stillstand erkennt man daran, dass nichts grundlegend Neues mehr gefunden, und ärger noch, nichts grundlegend Neues mehr gesucht wird. Es gibt in fast allen Disziplinen klaffende Löcher in unserem Wissen und Sachverhalte, die sich mit unseren fundamentalen Theorien und Erklärungsmustern nicht fassen lassen. Bei einigen haben wir nichtmal eine Ahnung davon, wie man die betreffenden Fragen zweckmässig formulieren müsste; also so, dass man sie methodisch in den Griff bekommen könnte. Das betrifft die Physik genauso wie die Biologie; aber infolge des Zwanges, in absehbarer Zeit publizieren zu können, wagt sich niemand daran. Stattdessen herrscht seit Jahren lärmende Simulation wissenschaftlichen Fortschrittes; das Kraus-Wort fällt einem wieder und wieder ein: „Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge einen Schatten.“
Ordnet man die Wissenschaft als Praxis im Sinne Aristoteles ein, dann ist Druck auf den Kessel zu geben so sinnvoll, wie einem Kind zu sagen: Spiel besser, oder spiel effizienter! Man zerstört lediglich das Spielhafte am Spiel. Die Wissenschaft löst ihr Versprechen am zuverlässigsten ein, wenn sie keins gibt und auch nicht gezwungen wird, eins zu geben.
Viertens: Geschützte Bereiche. Die zerstörte Trennung von Grundlagenforschung und angewandter Forschung.
Ich habe eingangs gesagt, dass ich keineswegs als grundsätzlich falsch ansehe, dass Forschung in Technologie und damit in Nutzen umgewandelt wird; ob dieser Nutzen schliesslich als Gebrauchswert oder Profit anfällt, ist, wie gesagt, eine Frage der Gesellschaftsordnung und durchaus zum Streitgegenstand geeignet.
Nicht zum Streit hingegen eignet sich die Frage, ob es eine klare Trennung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung geben sollte. Die ist unbestreitbar notwendig.
Die unklare Trennung von angewandter und Grundlagenforschung resultiert in einem Wurschtelbetrieb, der weder grundlegendes Verständnis der Phänomene auf der einen, noch neue Technologien und Anwendungen auf der anderen Seite ermöglicht. Stattdessen konkurrieren beide infolge der ubiquitären Drittmittelabhängigkeit um die selben Töpfe. Auch diese Fehlentwicklung ist längst eingetreten.
Beide, Grundlagenforschung und angewandte Forschung sind — institutionell gesehen — schützenswerte Bereiche. Aber beide benötigen eines anderen Schutzes und anderer Strukturen.
Von der angewandten Forschung war bislang noch gar nicht die Rede. Natürlich gibt auch eine Menge Forscher, die ganz explizit Nützliches schaffen wollen. Das ist eine völlig legitime Motivation. Ich selbst war etwa 15 Jahre bei der Fraunhofer-Gesellschaft beschäftigt, einer der weltweit größten Forschungsgesellschaften für angewandte Forschung und kann deshalb das Betreffende jetzt nachtragen: Die angewandte Forschung ist ein sehr anderer Bereich und es ist bis heute nicht heraus, wie man sie institutionell am gescheitesten verankert und fördert.
Es fängt damit an, dass in der angewandten Forschung sehr viel kürzere Zeitskalen bei sehr viel höheren Budgets vorherrschen. Eine grundlegende Entdeckung, die reif ist, in eine Technologie umgewandelt zu werden, muss schnell an den Markt, sonst patentiert — das heisst blockiert — sie jemand anders. — Über Sinn und Unsinn des Patentwesens müssen wir an anderer Stelle reden.
Hier ist auch nicht der Ort, die zweckmässige Organisation der angewandten Forschung zu besprechen. Ich will nur andeuten, dass ich selbst an die Kraft, Geschwindigkeit und Effizienz kleiner Ausgründungen, neudeutsch „Start-Ups“ glaube und dafür plädiere in Strukturen zu investieren, die diesen Weg des Forschungs-Transfers begünstigen. Je nach Innovations-Art und Markt sind Start-Ups großen, zentral gesteuerten Organisationen wie zB. Fraunhofer überlegen; aber das gilt, wie gesagt, nicht für alle Innovationen und Märkte. Es gilt aber in allen von den Lebenswissenschaften abgeleiteten Märkten. Dort sind fast alle Innovationen in den letzten Jahren durch Acquisition und Merger enstanden, also durch Einkauf kleiner innovativer Unternehmen und deren Technologien. Die in diesem Bereich tätigen grossen Fraunhofer-Institute arbeiten seit Jahrzehnten defizitär und erzeugen — im Gegensatz zu Startups wie zB. Moderna oder BioNtech — so gut wie keine wichtigen Innovationen. Man sollte also überlegen, wie man das Risiko für Start-Ups staatlich gefördert verkleinern könnte, etwa, dadurch, dass man im Fall eines Misserfolgs — eher die Regel, als die Ausnahme — Mitarbeiter vermittelt. So ginge deren Erfahrung und Wissen nicht verloren.
Insgesamt glaube ich, dass der Staat in der angewandten Forschung eher indirekt als Ermöglicher, Vermittler und Organisator auftreten sollte, denn direkt als Geldgeber.
Wie dem auch sei: Es geht mir nicht darum, an dieser Stelle konkrete Vorschläge zu machen; kann sein, mein Vorschlag ist schlecht und absehbar nicht funktionabel. Mir geht es hier vor allem darum, dass die Wissenschaft neue Strukturen benötigt, um Motivation und Möglichkeiten zur Entwicklung von Anwendungen und Technologien erzeugen. Und dass diese Strukturen klar von der Grundlagenforschung abgetrennt werden müssen. Das jetzige System erzeugt einen breiten und unguten Überlapp, der nicht nur dazu führt, dass beide Bereiche vorwiegend mit Geldeinwerben anstelle von Wissenschaft und Forschung beschäftigt sind; sondern darüber hinaus auch noch einander behindern, anstatt zu ergänzen.
Fünftens: Vernachlässigung der Lehre. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis als zentrales Paradigma der gesamten Wissenschaft.
Bekannt ist, dass auch die universitäre Lehre unter der Nutzens-Orientierung der Wissenschaft leidet. Es liegt natürlich daran, dass man in der Wissenschaft nur in der Forschung Ruhm und Fortkommen ernten kann, nicht aber in der Lehre. Die Lehre ist zur ungeliebten Pflicht geworden.
Vorlesungen beispielsweise sind zu einer Art Halde aus Wissens-Schüttgut geraten, die Studierenden sollen sich was raussuchen. Den Anspruch, einen zusammenhängenden Überblick über ein Wissensgebiet zu geben haben die Dozenten — wie auch die meisten sogenannten Lehrbücher — längst aufgegeben. Klausuren werden auch in den Naturwissenschaften als Multiple-Choice Tests abgehalten, das Niveau — oder vielmehr die übertriebene Spezifität — vieler Fragen ist, nunja, fragwürdig. Die universitäre Lehre wird immer mehr zu einem verschulten Massenbetrieb, der wesentlich darauf optimiert ist, dass das Lehrpersonal möglichst wenig Zeit auf ihn verschwenden muss. Gleichzeitig wird das Risiko minimiert, dass Studierende vor Gericht gegen schlechte Noten oder Sicherheitsmängel in einem Praktikum usw. klagen. Das sind die momentanen Anreize, besser gesagt Nicht-Anreize in der Lehre.
Solche und andere Mängel haben zu einer langsamen, aber gefährlichen Erosion der Wissenschaft geführt. Junge Menschen, die nie gelernt haben und nie ermutigt wurden, selbst wissenschaftlich zu denken, schaffen natürlich zunehmend eine unwissenschaftliche Atmosphäre. Damit meine ich vor allem die Unfähigkeit, wissenschaftliche Ambiguität auszuhalten; die wachsende Unlust, nach schwierigen und unbekannten Fragen zu suchen; und die fehlende fröhliche Anarchie, mit der die Wissenschaft ihre eigene Praxis immer wieder hinterfragt und neu organisiert hat. Anstelle neugieriger Entdecker und gründlicher Denker züchten wir kleine Bürokraten und Selbstdarsteller. Das ist die Schuld des Betriebes, nicht die der Schüler.
All das, wie gesagt, ist bekannt und kann und wird sich nicht bessern, solange Wissenschaftlerinnen ihre Schulterstücke vornehmlich in der Forschung, durch Publikationen und Preise gewinnen, anstatt in der Lehre.
Nun waltet an genau dieser Stelle ein tieferes Geheimnis der Wissenschaft. Es geht nicht nur darum, neugierige, kompetente und schaffensfrohe Wissenschaftlerinnen heranzubilden. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist sehr viel umfassender und, wenn man es recht bedenkt, zentral konstitutiv für die Wissenschaft überhaupt. Wenn unstrittig ist, dass Wissenschaft Wissen schafft, dann folgt mit der selben Unstrittigkeit, dass diese Praxis sich als ständiges Lehren und Lernen auffassen lässt.
Als soziale Praxis ist die Wissenschaft genau das: Ein Kollektiv, in dem die Rollen des Lernenden und die des Lehrenden ständig von einem zum anderen springen. Wer etwas Neues entdeckt oder erfindet, wird zum Lehrer; das restliche Forschungskollektiv zum Lernenden. Wissenschaftliche Kritik kann die Gestalt des nachfragenden Schülers annehmen, oder die des weisenden Lehrers. Wissenschaftler, die eine Theorie überprüfen oder deren Grenzen ausforschen — sagen wir, die der Evolutionstheorie — befinden sich in gedanklichem Austausch mit den Schöpfern dieser Theorie. Sie sind Schüler Darwins, hundertfünfzig Jahre nach ihm; aber sie können ihn auch überschreiten und zu Lehrern künftiger Generationen werden.
Das Lehrer-Schüler-Verhältnis, will ich sagen, wird immerfort und überall in der Wissenschaft betätigt; es geht quer durch die Labore und Universitäten, quer über Länder und Grenzen, aber auch quer durch die Zeit; es ist das große Geflecht, dass die Wissenschaft in ihrem Innern zusammenhält. Die selbst auferlegte Pflicht der Wissenschaft, Wissen zu rechtfertigen und ihre Selbstverpflichtung, Wissen öffentlich zu machen, sind ganz einfach nur andere Arten, das universelle Lehrer-Schüler-Verhältnis zu beschreiben, dass konstitutiv für sie ist.
Wieder fehlt Zeit, den Gedanken, der über das Gesagte hinaus auch psychologische und philosophische Aspekte enthält, vollends auszuführen. Stattdessen komme ich sogleich auf seine Folgerungen und an den Schluß meines Referats: Ich mache einen Vorschlag. Ich bilde mir ein, dass er nicht allein die Symptome der Krise zu lindern, sondern ihre vielfachen Ursachen — mit nur einer einzigen Maßgabe! — bekämpfen könnte. Diese Maßgabe lautet, institutionell darauf zu achten, das Lehrer-Schüler-Verhältnis in den Fokus zu rücken und, wo möglich, zu stärken und zu fördern.
Was das konkreter heissen könnte: Erstens ganz offenkundig und direkt Geld und Zeit für die Lehre; das heisst für Personal in der Lehre. Anstatt die Gelder als Projektgelder für Forschungsprojekte zu verwenden, sollte das Geld direkt in Stellen für Lehrpersonal fliessen; das heisst Giesskanne und das heisst auch, den fast vollends erodierten Mittelstand in der Wissenschaft wieder aufzubauen.
Zum Zweiten heisst das: Begrenzung der Größe von Forschungsteams, sowohl nach oben, als auch nach unten. Es ist bekannt, dass Gruppen von ca. 3 bis 7 Forscherinnen am effizientesten arbeiten; vor allem sollte der Matthäus Effekt — wer hat, dem wird noch mehr gegeben — gezielt eingedämmt werden, d.h. keine unnütz grossen auf Kosten vieler kleiner Gruppen.
In der Wissenschaft gilt das Marktprinzip „Stärken stärken und Schwächen schwächen“ nicht; stattdessen gilt, dass Schutz, also Vielfalt und Freiheit zu Ideenreichtum und Risikofreude führen. Deswegen braucht es übersichtliche Gruppengrössen, damit jeder gesehen und gefördert werden kann. Natürlich gibt es Bereiche in der Forschung, die eher generalstabsmässig organisiert werden müssen, wie zum Beispiel der Bau und Betrieb von einem Synchrotron oder andere Großforschungsanlagen. Nichts dagegen zu sagen. Aber das sind eher Ausnahmen und gerade in den Lebenswissenschaften, die ich hauptsächlich meine, nicht an der Regel. Die meiste wichtige Forschung geschieht in Einzelleistungen und kleinen Teams.
Zum dritten bedeutet das die Schaffung von Räumen für wissenschaftliche Debatten und die Fördeung von wissenschaftlichem Dialog. Das kann natürlich nur stattfinden, wenn die herrschende Konkurrenz unter den Forschern endlich wieder abgemildert anstatt gezielt befeuert wird. Ganz wird sie eh nie verschwinden. Der gemeine Forscher ist in der Regel ein Ego-Tier, ein kompetitiver und hyperehrgeiziger Zeitgenosse. Oft genug aus eben diesem Grund unangenehm und als Debattierpartner — Lehrer oder Schüler — nicht gerade erste Wahl.
Man muss diese grundsätzliche Lage aber nicht auch noch verschlimmern, indem man die Existenz der Wissenschaftler nach Art des freien Marktes an ihren wissenschaftlichen Erfolg knüpft. Mein Vorschlag lautet, dass man die Eingangshürden des Betriebs sehr viel höher macht, als sie jetzt sind; und dafür die existentielle Bedrohung abschafft, sobald man einmal die Hürden überwunden hat. Die Zugangs-Hürden selbst sollten mehrstufig und zunehmend weniger formal sein. Auch das kann letztlich nur an ein funktionierendes Lehrer-Schüler-Verhältnis geknüpft werden, also daran, dass man im wissenschaftlichen und persönlichen Umgang miteinander lernt, ob jemand für die Wissenschaft geeignet ist, oder nicht.
Zum vierten liessen sich auch die Gehälter der Professoren senken; nicht nur würde das Mittel freisetzen, mehr Stellen zu schaffen und die obigen Ideen zu finanzieren. Ich bin darüber hinaus der Meinung, dass es generell keinen finanziellen Anreiz geben sollte, Professor zu werden. Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter sollten auf gemeinsamem Gehaltsniveau und mit ähnlicher Freiheit der Forschung miteinander arbeiten. Professor soll nicht werden, wer nach Prestige oder Wohlstand strebt, sondern Wissenschaftler, die eine besondere didaktische Begabung haben oder zumindest ein didaktisches Bedürfnis verspüren.
Fünftens befürworte ich, Zeit und Raum für das Schreiben von Lehrbüchern und Monographien zu schaffen. Beispielsweise wäre es gut, wenn man die Möglichkeit erhielte, in seiner akademischen Laufbahn insgesamt zwei Jahre ein Sabbatical für solche Schreibvorhaben zu nehmen. Man könnte sich dann überlegen, ob man die zwei Jahre am Stück für ein Schreibvorhaben nimmt, oder zwei mal ein Jahr für zwei Bücher etc. In jedem Fall erachte ich als sehr erstrebenswert, Wissenschaftlern die Ruhe zu geben, lange und gründlich und von der täglichen Hektik des Betriebes unbelastet über ihr Gebiet nachzudenken.
Gut. Fünf Problemfelder habe ich vorgetragen; fünf Verbesserungsvorschläge habe ich gemacht. Das scheint mir eine ausgeglichene Balance. Ich könnte mehr lamentieren und ich könnte, umgekehrt, auch mehr vorschlagen. Aber einmal müssen wir Schluss machen. Ich schlage vor: Jetzt.
Vielen Dank!
[1] von 272.000 auf 452.000
[2] 2005: 255.253€/Forscher; 2022: 295.741€/Forscher