Wer sich einmal unter Christenmenschen erkundigt hat, wer oder was Gott sei, wird vielleicht erstaunt über die Unterschiedlichkeit der Antworten gewesen sein.
„Die Liebe“, sagt der eine. „Das Prinzip des Guten“, meint der andere. „Ein allwaltender Geist der Barmherzigkeit“, ist wieder einer überzeugt. Und so weiter.
Sie kennen das wahrscheinlich. Nun, dann wissen Sie auch, daß die häufigste Antwort lautet: „Was Gott ist? Das kann man nicht sagen.“
Im Grunde ist damit schon viel von dem bewiesen, was ich im Folgenden ausführen möchte. Gott ist kein klares, einheitliches Ding oder Wesen oder Wirkprinzip; er liegt sozusagen, und lag wahrscheinlich immer schon seit er einzig ist, in chronisch dekonstruierter Form vor.
Die Vernünftigen unter den Theologen sind sich dieser Zersplittertheit Gottes natürlich bewußt; möglicherweise reden sie lieber von Vielgestalt als von Zersplitterung. Sebst innerhalb ihrer Zunft – gerade in der – wird wenig Einmütigkeit über Gott herrschen. Manche kehren diese Mißlage in ein Argument um und nehmen die Verschiedenheit der Gottesvorstellungen als Beleg, wie wenig das menschliche Denkvermögen Gott zu fassen vermag und wie überaus gewaltig Gott sein müsse, wenn selbst alle Menschenhirne zusammen genommen keine schlüssige Gestalt aus ihm gewinnen können.
Immerhin, soviel können wir den meisten Antworten entnehmen, daß es sich bei Gott um eine Art Limes handelt; Gott führt ein Prinzip oder ein Vermögen oder eine Art des Vorkommens an eine absolute Grenze. Meist ist es auch eine Grenze des Denkbaren. Zum Beispiel Gott sei der Anfang von allem, oder der Schöpfer von allem oder die absolute, reine Liebe. Vielleicht darf man daraus ableiten, daß Gott in jedem Fall die Denkbewegung, und sicher auch eine Fühlbewegung hin zu einem Absoluten ist und in der Regel auch dessen Verdinglichung.
Natürlich, Sie merken es schon, argumentiere ich wie ein Skeptiker. Man riecht den Atheisten. Es wird wohl daran liegen, dass ich einer bin. Ich würde von mir allerdings als von einem wohlwollenden Atheisten reden, d.i. von einem Atheisten, der an den Argumenten religiöser Menschen ein ehrliches Interesse hat; der ihnen gern lauscht und auch ihre Rolle in der Kulturgeschichte nicht bestreiten will.
Einer also, der nicht immerfort auf den vernunftsverderbenden und entmündigenden Tendenzen der Religion herumreiten mag. Wozu denn auch? Die unsinnigste Art des Streits besteht doch im wechselseitigen Vorwurfsmachen. Ausserdem verhält es sich, daß einige der klügsten und interessantesten Menschen, die kennenzulernen ich das Vergnügen hatte, nun einmal religiös sind.
Leider bin ich religionsgeschichtlich zu wenig unterrichtet, um sagen zu können, ob immer schon in der Menschheitsgeschichte auch bekennende Atheisten vorhanden waren, glaube aber, es waren. Man weiß von ihnen erstaunlich wenig. Stattdessen erhält man den Eindruck, selbst bei oberflächlichem Durchgehen der Geschichte, es seien die Menschen immer gläubig gewesen, von Elementargöttern (Feuer-, Fruchtbarkeits- und Sonnengöttern), über die Vielgötterei der Ägypter, Griechen und Römer hin zu den heutigen monotheistischen Weltreligionen.
Dass man von den Atheisten der Frühzeit so wenig gehört hat, hat Gründe. Die Herrschenden, die den größten Teil der Geschichtsschreibung besorgten, waren eben auch immer mit den Göttern im Bunde. Und seit Religion Sache der Politik war – seit Anbeginn also – seither hatten Atheisten es schwer. Sie waren stets in der Minderheit, stets stigmatisiert, wo nicht kriminalisiert und mussten in ihrer religiösen Welt weitaus größere Geistes- und Lebensanstrengungen unternehmen, als ihre religiösen Zeitgenossen, die den Glauben einfach mehr oder minder kritisch übernahmen.
Die Zeiten haben sich geändert. Zwar ist die erdrückende Mehrzahl der Menschen noch immer religiös, aber es haben Religion und Staat begonnen sich zu entflechten. Laizismus gilt vielerorts als zivilisatorisches Ideal und es hat, seit ungefähr zweihundert Jahren, ein anhaltendes Streitgespräch zwischen Atheisten und Gläubigen statt.
Von diesem Streit will ich handeln. Es geht mir dabei weniger um die Argumente beider Seiten, als um die prinzipielle Natur dieses Streites. Natürlich gibt es daneben eine Strömung (auf beiden Seiten), die ihre jeweilige Position als nicht rechtfertigungsbedürftig oder als nicht rechtfertigbar, erachtet; Agnostiker zum Beispiel. Von denen sehe ich ab.
Mir geht es um diejenigen, die des Debattierens nicht müde werden und durchaus eine Pflicht angenommen haben, ihre Überzeugungen zu rechtfertigen. Für diese Leute will ich versuchen, den Wurzelgedanken jeder Debatte zwischen Atheisten und Gläubigen einmal recht deutlich an Tag zu bringen.
Der Wurzelgedanke ist grob gefaßt folgender: Im Grunde muss doch einem gottesfürchtigen Menschen jede Debatte über Gott als superkluge Sophisterei erscheinen. Er streitet mit dem Atheisten wie der Sehende mit dem Blinden über Farben und Formen. Irgendwie kann man einander zwar Worte geben, aber am Ende bleibt ein substantieller Rest des Unzeigbaren oder Unweisbaren, der die ganze Debatte, recht betrachtet, sinnlos und schal macht.
Andererseits ist das mit *allen* Debatten der Fall, in denen es um grundlegende Überzeugungen geht. Immer ist es ein Blinder, der mit einem Tauben um Farben und Töne streitet.
Ich übertreibe, um zu verdeutlichen.
Aber bei aller möglicher Übertreibung ist es doch genau aus ungezählten solcher Verständigungsversuche, daß ich zwar unterdess die Fähigkeit gewonnen habe, einen Gläubigen intellektuell aufs Kreuz legen zu können (der Ausdruck ist treffend, nicht wahr?), endlich aber am eigentlichen Kern seiner Botschaft regelmäßig vorbei argumentiert – in dessen Wahrnehmung womöglich eben superschlau „getrickst“ zu haben.
In der Tat diskutieren beide Seiten nicht selten aus dem geheimen Beweggrund, sie müßten die Taschenspielertricks des anderen aufdecken. Der Dialog, wie alle mißlingenden Dialoge, wird schon im Ansatz von wechselseitigen Unterstellungen behindert. Der Gläubige unterstellt dem Ungläubigen die Verdrängung seiner, wie er überzeugt ist, immer vorhandenen Teilhabe an Gott; der Ungläubige wiederum unterstellt dem Gläubigen Irrationalität und Geisterglaube, vielleicht sogar die Sehnsucht nach Unterwerfung. So geht es dann hin und her in der Absicht, einander die okkulte Psychologie Glaubens – oder Nicht-Glaubens – nachzuweisen. Klärung und Verständnis rücken keinen Deut näher.
Warum ist das so? Warum ist ein Gespräch zwischen Atheisten und Gläubigen oft so unerspriesslich?
Zwei Richtungen fallen mir ein, in welche diese Frage fortgedacht werden kann. Erstens in Richtung des Substanz-Begriffes, welcher den philosophischen Kern der Sache ausmacht. Man wird auf die These geführt, dass von einer Substanz jenseits ihrer Erfahrung nicht zu reden geht. Reden, besagt, diese These, kann man immer nur über Struktur und Form. Diese sind Sachen des Geistes; Substanz aber ist Sache der Erfahrung.
Möglicherweise haben wir damit sogar das Wesen der Erfahrung auf ihren Begriff gebracht. Was von einer Sache nach Abzug aller Form – d.h. ihrer Gegebenheit im denkenden Geiste – übrig bliebe, ist ihre Art des Sichanfühlens, ihre Gegebenheit im fühlenden Geist, ist, mit klassischem Wort: Substanz.
Von Gott wird nun behauptet, er sei *nur* Substanz; ja, nicht allein das, er sei überhaupt die substanziellste aller Substanzen. Damit mag vielleicht gemeint sein, dass Gott die Möglichkeitsbedingung von Substanz ist; dass er, als einzige Substanz ohne Form alle anderen – irgendwie geformten und strukturierten – Substanzen durchflutet und ihr Grund ist. Wie es auch im Einzelnen um die Substanzialität Gottes bestellt sein mag; wenn dem so ist, wenn also Substanz an Erfahrung geknüpft und Gott nichts als Substanz ist, leuchtet ein, daß ein Gläubiger und ein Atheist wenig haben, worüber sie debattieren können.
Das Nachdenken über den Substanzbegriff also führt uns nur in eine Sackgasse, die das Bekannte bestätigt, dass nämlich Gläubigen und Atheisten ein gemeinsames Substrat fehlt, auf das sich ihre Argumente beziehen können.
Weswegen wir zu zweitens kommen: Zweitens kann man in die religionspraktische Richtung verfahren und nach den Möglichkeiten fragen, mit denen man sich *praktisch* auf Gott beziehen kann? Praktisch ist Gott zwar – zumindest in den abrahamitischen Religionen – immer durch das Wort offenbart, aber der tatsächliche Gottesbezug liegt nicht im Lesen oder Denken oder Debattieren, sondern im *Glauben*, sowie ferner im Offenbart- und Erleuchtetsein. (Gut. Letzteres hat seit dem Ausdermodekommen der Gnosis seinen Rang eingebüßt. Aber es geht beim Bezug auf den christlichen Gott ohne Zweifel um eine Sache der Innerlichkeit.)
Welchen Sinn kann es haben, angesichts dieser eigentlichen Praxen, sich auf Gott zu beziehen und obendrein ohne Bezug auf den Wortlaut der Bibel dennoch von Gott zu reden und über ihn zu debattieren? Das Dilemma persistiert.
Es sieht so aus, als versagte nach dem Substanzbegriff nun auch der Pragmatismus, demnach die Bedeutung eines Wortes in seinem praktischen Gebrauch läge, vor Gott. Aber der Schein trügt.
Die Juden machen vor, wie eine pragmatische Antwort auf die Frage nach Gott aussehen kann. Im Unterschied zu den Christen fordern sie nicht erst den Gottesglauben ein, um auf dieser Grundlage alle anderen religiösen Gedanken überhaupt erst kommunizierbar zu machen. „Glaubensbekenntnis, Schnaubensbekenntnis!“, nein, das braucht kein Jude. Statt des Glaubens genügte es ihrem Gott, wenn der Mensch, gläubig oder nicht, sich nur mit ihmselbst auseinander setzt. Demnach wäre Richard Dawkins, wenngleich ein mieserabler Christ, wohl doch wenigstens ein guter Jud? Das nun auch nicht. Die Juden verlangen eine wohlwollende, gleichsam fromme Beschäftigung mit Gott, überdies und nebenbei in Beherzigung der 248 Ge- und 365 Verbote der Thora.
Einfach gesagt verlangt das Judentum äussere Gottesfurcht, an welche Stelle dann das Christentum einen inneren Gottesbezug gesetzt hat.
Es ist eine durchaus schroffe Peripetie, diese Verlagerung Gottes aus dem äusseren Leben ins innere, schroffer jedenfalls als das artige Gebundensein von Altem und Neuem Testament an ihren gemeinsamen Buchrücken uns glauben machen möchte. Der Verdacht drängt sich auf, daß diese Wende gleichzeitig die Saat der Dekonstruktion Gottes war. Die Christen haben Gott getötet. Sie haben seine ursprüngliche und schwer erarbeitete Einheit in Millionen gläubiger Seelen eingesplittert, indem sie ihn zu einer Sache der Innerlichkeit machten. Ich sage das nicht der Christenheit zum Tadel; ich sage es zu ihrem Lob.
Ansonsten kann ich den Juden zustimmen. Wo man sich in ein solch äußerlich-gottesfürchtiges Leben begibt, kommt es auf den Glauben dann auch nicht mehr an. Sie haben die mißlingende Debatte über Gott einen Schritt weiter geführt und auf das praktische Handeln und den Lebensvollzug verlagert. Setze Dich, sagen Sie, wenn Du Gott erkennen willst, nicht mit dem Glauben auseinander, sondern in gottesfürchtiger Weise mit dem Leben; die Ahnung, die sich auf diese Weise von Gott vermittelt, reicht dann für irdische Verhältnisse hin.
Natürlich ist das genauso gemogelt, wie ein superkluges atheistisches Argument. Wer stets in Hinblick auf Gott sich verhält, der wird früher oder später immer zu einer Art „Einsicht in die Notwendigkeit“ gelangen; für ihn müssen irgendwann Lebenserfahrung und Gotteserfahrung in eins fallen. Er hat ja gar keine Wahl.
Gleichzeitig aber sagen die Juden, es sei gerade die Fähigkeit zu wählen, was Gott den Menschen gegeben hat. Freiheit, mit anderen Worten; Freiheit auch, wenn es einen (schlechten) Menschen beliebt, von Gott selbst.
Der Gedanke ist selbstverständlich weniger kühn, wenn man ihn in die Klammer eines richtenden Gottes bzw. eines gottesfürchtigen Lebens pfercht, aber, wie man weiss, sind die Gedanken freier als die Menschen und so hat dieser Gedanke sich zu einer großen Macht von seinen ursprünglichen Denkern emanzipiert.
Er kehrt zurück als Debatte zwischen Atheisten und Gläubigen. Die Bewegung war die einer wachsenden Zelle. Sie hat sich gedehnt und geweitet, bis sie, nach Erreichen einer kritischen Größe, in zwei Tochterzellen sich teilte, von denen jede nun kleiner ist, als die Mutterzelle.
Die Mutterzelle, das waren die Kirchendenker und religiösen Gelehrten, die immer weitergreifende und klügere Systeme errichteten, bis ihre Lehren endlich in einen gläubigen und einen nicht-gläubigen Teil zerfielen, die nun gegeneinander streiten. Was ihren Streit so unproduktiv macht, ist der Verlust des jeweils anderen Teils.
Plädiere ich also für die Rückkehr zu einem frommen Atheismus, wie ihn beispielsweise Leibniz und Spinoza pflogen (sie sind die letzten noch in der Mutterzelle schaffenden; nach ihnen vollzog sich besagte Zellteilung)? – Gewiss nicht. Rückkehr ist immer Mumpitz.
Nein, ich bin dafür, den Gottesbegriff aufzuheben. Er hat, meine ich, seit jener Zellteilung seine welthistorische Schuldigkeit getan. Es will mir logisch vorkommen, daß auf die Vielgötterei der Monotheismus folgte und auf den schliesslich die Aufhebung Gottes.
Aufheben bedeutet in diesem Fall Auflösung; Rückverwandlung der Einheit in Vielheit.
Gott ist eine Verknotung der unterschiedlichsten Dinge, Handlungen, Gedanken und Gefühle, ihr Zusammenzug in Eins. Wir haben ja längst begonnen, die Fäden, die da zusammenlaufen, zu entwirren. Ihr Eins-Sein mag eine Erfahrung sein, die erhebend und erleuchtend ist; die Kindheit fühlt sich auch als eine selige Zeit an, aber das Leben verlangt nach Ausdifferenzierung der in dieser Seligkeit angelegten Entwürfe.
Dahin, meine ich, muss die Debatte zwischen Gläubigen und Atheisten geleitet werden. Wir Atheisten müssen den Gläubigen die Möglichkeit anbieten, Gott in anderen Vorstellungen aufzuheben. Trost, Letztbegründung, Substanz, Transzendenz: All das, wonach der fromme Mensch sich sehnt und worin er Erbauung findet, muss ihm weiter erfahrbar bleiben. Dann nämlich wiederelangen wir auch peu a peu ein gemeinsames Substrat, auf das wir uns in besser gelingenden Debatten beziehen können.
Beginnen wir gleich hier, gleich jetzt. Wozu warten? Dekonstruieren wir Gott!
Natürlich ist der Anspruch vermessen. Gott dekonstruiert man nicht mit einem Essay. Aber ich muss es auch gar nicht tun! Er liegt ja, wie eingangs gesagt, schon immer dekontruiert vor. Ich muß ja nur auf die unterschiedlichen Richtungen zeigen, in die Gott weist. Von den vielen Richtungen nehme ich auch nur die oben genannten vier: Trost, Letztbegründung, Substanz und Transzendenz. Ich meine, sie sind schon in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit geordnet.
Trost
Beginnen wir also mit dem Trost. Trost war immer eine der anziehendsten Seiten von Religion. Dreierlei Trost, mindestens dreierlei, hat die christliche zu bieten.
Erstens die Allgegenwärtigkeit Gottes. Darin enthalten ist das Versprechen, nie allein auf dieser Welt zu sein und jederzeit, in der Regel qua Gebet, ein Wort an Gott richten zu können.
Zweiter Trost ist das Versprechen eines Lebens nach dem Tode und eines Reiches, in dem wir uns alle wiedersehen. Dieser Trost ist in dem Maße marginalisiert worden, wie der Tod aus unserer Gesellschaft gedrängt wurde; seltsamerweise findet der Christenmensch der Jetztzeit weit weniger Trost im Versprechen des Paradieses, als es früher der Fall gewesen zu sein scheint. Vielleicht glaubt er einfach nicht mehr daran; vielleicht ist er ja auch erleichtert, niemanden mehr wiedersehen zu müssen; ich weiss es nicht.
Drittens schliesslich ist auch das Versprechen einer umfassenden Gerechtigkeit Gottes für viele Christenmenschen ein großer Trost, an dem sie sich aufrichten können. Dieser Glaube kommt in mehrerlei Varianten daher; in seiner extremsten Form ist er im jüngsten Gericht formuliert; in abgeschwächter Form dann in der Idee, daß gottgefällige Menschen in den Himmel, Sünder aber in die Hölle kommen; und am schwächsten schliesslich in der Idee, daß Gott allen Sündern vergibt, da Jesus durch seinen Tod am Kreuz alle Schuld auf sich genommen habe.
Man kann die Stärke dieser Versprechen auch umgekehrt werten, aber unerachtet dessen steht am Ende in jedem Fall die Löschung eines imaginierten Schuldregisters, das eben von Gott für jeden geführt wird. Leider geschieht diese Schuldlöschung jedoch erst im Ende aller Zeit, ausser man nimmt an, Jesus hätte das bereits und mit Gültigkeit bis zum Ende aller Zeit erledigt.
Allgegenwart, Paradies und umfassende Gerechtigkeit, dies sind die drei großen Trostmomente (des christlichen) Gottes. Was liesse sich an deren Stelle setzen? Wie liesse sich der tröstende Gott, und die Menschen mit ihm, aufheben?
In allen drei Fällen handelt es sich um ein Versprechen, dessen Einlösung nicht von dieser Welt ist; das heisst, doch, dessen irdische Einlösung eben im Trost liegt, den es spendet. Gibt es ähnliche Versprechen in der weltlichen Welt?
Ja und nein. Beginnen wir mit der Gerechtigkeit. Seit der französischen Revolution ist der Gedanke schwer im Schwange, es könne Gerechtigkeit unter Menschen nur von Menschen hergestellt werden. Man kann nun, und mit einigem Recht, sehr skeptisch gegen solche Kühnheit sein. Gerade die französische Revolution mit ihrem wahllosen Kopf-ab, Blaupause unzähliger Gräueln!
Aber darum geht es gar nicht, das wäre ja ein Rückfall in die Manier des Vorwurfmachens. Hier geht es um das Versprechen, das durch die französische Revolution gegeben ward. Und das tut, trotz der Ungerechtigkeit der Revolution selbst, seither in der Welt seine Wirkung. Es lautet, im Unterschied zum christlichen Versprechen, daß Gerechtigkeit schon hienieden und vom Menschen selbst herstellbar sei.
Man kann diese Verheissung zwar durch die Frage schmälern, woher der Mensch überhaupt eine Vorstellung von Gerechtigkeit nähme, wenn nicht von Gott, aber das wäre ein durchsichtiges Ablenkungsmaneuver. Denn egal, woher er seine Ahnung von Gerechtigkeit nehmen mag, bleibt bestehen, daß er, wenn er sie nun einmal hat, sich auch selbst um deren Verwirklichung kümmern muss – und kann!
Das leuchtet ein. Wenngleich wir ahnen mögen, daß uns nicht unbedingt gelingen wird, ein Paradies auf Erden einzurichten, sind wir doch zuversichtlich genug, ein gerechteres Morgen erschaffen zu können, wofern wir nur redlich uns mühen. Aus dem gerechteren Morgen wird dann ein noch gerechteres Übermorgen und so weiter. Den Nachteil, niemals in ein Paradies einzugehen, nehmen wir für die Hoffnung in Kauf, es schon im Diesseits besser machen zu können. Diese Hoffnung ist bereits vieler Menschen Trost und sie hat wahrlich das Zeug zu einem Menschheitstrost.
Schlechter verhält es sich mit dem Trost, welcher in der Allgegenwart Gottes liegt. Zu wem soll der Atheist sprechen, wenn er allein ist? Wer hört ihn, wer achtet auf ihn?
Ich gebe zu, hier weiss ich keine Antwort. Einsamkeit bleibt Einsamkeit, daran nützt ja alle Deutelei nicht.
Andererseits: Auch der Tod ist stets der Tod geblieben; nie hat er seinen Schrecken und seine Unheimlichkeit verloren. Trotzdem kommen unterdessen viele Christenmenschen ganz ohne Glaube an ein Paradies aus. Jahhundertelang war das Paradiesversprechen ein gewaltiger Trost. Jetzt ist es aus der Mode.
Könnte dem Versprechen der Allgegenwart Gottes nicht das selbe Schicksal widerfahren, wie dem Paradies-Versprechen? Ist nicht denkbar, dass wir lernen, mit einem Schrecken zu leben, ohne tröstendes Versprechen?
So abwegig will mir das nicht scheinen. Wenn selbst Christenmenschen dem Tod ohne Parasiesglauben begegnen können, sollte mit Einsamkeit erst recht zu leben gehen.
Möglicherweise lernen wir, was die Dichter Goethe und Hacks „heiteren Resignation“ genannt haben. Heitere Resignation, das meint in diesem Fall, wir lernen in befreiender Ernüchterung, daß die Wirklichkeit weder für den Tod noch für die Einsamkeit einen Trost bereit hält.
Überhaupt meine ich, daß jeder Mensch sich letztlich an sich selbst aufrichtet und aufrichten muss. Der Glaube an Gott kann ihm bestimmt helfen; aber tun muß er es in jedem Fall selbst.
Vergessen wir nicht, daß Matthäus berichtet, es seien Jesus letzte Worte am Kreuz gewesen: „Eli, Eli, lema sabachtani? – Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“. Auch der Tiefgläubige, beweist das, ist der Arbeit des Sichaufrichtens nicht überhoben.
Warum also nicht gleich sich darin üben, wissend, man selbst und niemand sonst muss der Vollbringer dieser Mühe sein? Ist das nicht wiederum mündiger und ehrlicher gedacht? Natürlich, besonders tröstlich ist es nicht. Mündigkeit und Ehrlichkeit sind ja meist das genaue Gegenteil von Trost.
Man sieht bereits, dass wir Gott an manchen Stellen nicht ersetzen können. Aber ich sage auch nicht Ersatz. Gott kann man nicht ersetzen, aber man kann die Debatte um ihn erleichtern und systematisieren. Nur darum geht es vorerst.
Vielleicht ist das irdische Jammertal nicht mehr so jämmerlich wie dereinst; vielleicht sind wir weniger trost- und also gottesbedürftig. Die Gläubigen sagen oft, wenn man sich Gott wegdächte, entstünde eine Leerstelle im Menschen. Nun, ich würde es auf den Versuch ankommen lassen. Mein Eindruck ist, daß in dem Maße, wie beispielsweise die Kriegswilligkeit des Menschen schwächelt, wenn er gut zu essen hat, auch seine Gottesbedürftigkeit zur Schwäche neigt, wenn er nur gut leben darf.
Damit soll nicht gesagt sein, daß eines das andere ersetzen könne. Gottesbedürftigkeit ist mehr (und weniger) als Sehnsucht nach einem guten Leben (und Tod). Dennoch, finden Sie nicht auch, daß es was von einem Zusammenhang hat, wenn die Atheisten in eben dem welthistorischen Moment ihren ersten großen Zulauf fanden, in dem Güter und Reichtümer aufgrund ihrer maschinellen Herstellungsweise allgemein verfügbar wurden, als Medizin und Hygiene anfingen, die gemeinsten Krankheiten zu bezwingen, als die ganz harte körperliche Frohn von Maschinen übernommen wurde, etc. etc. – ?
Da flammte doch allgmein ein Prometheusglaube auf, an dessen bescheidenem, irdischen Feuer der Mensch über seine Aufgabe Gottes sich hinweg trösten kann. Darüber, daß er das Holz für dieses Feuer selbst sammeln und nachlegen darf vergißt er seinen Kummer.
Ich finde auch, es glost und knackt und wärmt.
Letztbegründung
Soviel vom Trost. Kommen wir zur Letztbegründung. Letztbegründung meint, daß wir mit Gott einen verlässlichen ersten Grund zur Hand haben, der uns sonst vielleicht nicht gegeben wäre.
Woher die Sehnsucht nach ersten Gründen kommt kann ich nicht sagen. Lichtenberg nennt den Menschen das „Ursachentier“ und das scheint mir Herkunftsauskunft genug. Wir schnüffeln nach Gründen, wie das Trüffelschwein nach Trüffeln und aus ziemlich denselben Gründen.
Aber es gibt Gegenstände, deren erste Gründe wir besonders gern wüssten. Wie die Welt geschaffen wurde, woher die Maßgaben für richtiges und falsches Handeln sich leiten, welchen Sinn das Dasein des Menschen auf der Erde hat und wo er überhaupt herkommt?
Obwohl dies alles klassische Fragen sind, spielen sie im Alltag der meisten Menschen eine ganz nebenrangige Rolle. Eine erheblich unwichtigere jedenfalls, als beispielsweise der Trost, dessen jeder Mensch viel dringender und viel unmittelbarer bedarf. Ob wir mit Gewissheit sagen können, wie unsere Welt entstanden ist, ist gegen solch lebenspraktische Fragen doch ganz lächerlich und bedeutungslos.
Des unerachtet sind die Fragen der Letztbegründung das wüstest umkämpfte Gebiet zwischen Atheisten und Gläubigen. Aus Gründen, die ich nicht weiß, wollen Atheisten oft lieber Besserwisser als Bessertröster sein. Sie können da sehr eifrig werden.
Ich bin Wissenschaftler. Mich regen diese Dinge nicht auf. Mich regen sie bestenfalls an. Aber gut. Ich muß diese Laxheit wahrscheinlich ein bisschen begründen.
Nehmen wir also zum Exempel der Frage nach der Herkunft der Welt: Wurde sie geschaffen oder ist sie entstanden und wenn ja, wie, etc.? – Wie man weiß, scheint hier die christliche Schöpfungsgeschichte mit der Urknall-Theorie zu widerstreiten. Ich sage „scheint“, weil ich glaube, daß es zwischen Letztbegründungen keine logischen oder ontischen oder sonstigen Widersprüche oder Rivalitäten geben kann; Letztbegründungen werden immer Fragen des Glaubens sein. Vielleicht sogar nur eine des Geschmacks.
Natürlich wird nun ein Atheist einwenden, der Urknall wäre aus nachprüfbaren Fakten gefolgert, wohingegen die Annahme eines Schöpfergottes eine ganz und gar närrische Phantasterei sei, frei erfunden, durch nichts beweisbar und überhaupt eher im Reich der Schnurren und Märchen als der Wirklichkeit beheimatet.
Mag sein, das ist der Fall. Aber es tut wenig zur Sache. Die Frage ist, ob die Urknall-Theorie tatsächlich mehr ist, als eine andere Schöpfungsgeschichte, bzw. ob es überhaupt eine Erstbegründung geben kann, die „wissenschaftlicher“, im Sinne von überprüfbarer, einsichtiger, thesenminimalistischer etc. sei? Ich meine nicht. Nicht wirklich.
Die Urknall-Theorie wurde ja aus der Beobachtung gefolgert, daß die Materie im All auseinanderstrebt (Im Übrigen, rätselhafterweise, wie man nun weiß, sich beschleunigend auseinander strebt.). Aus der Sternenflucht folgert ein Ursprung dieser Bewegung, der Urknall gennant wird. Nebenher gesagt macht die erwähnte Beschleunigung des Auseinanderstrebens andere Bewegungsursachen wahrscheinlicher als den Urknall. Aber bleiben wir bei dem; er ist schliesslich momentan noch sehr populär.
Man wird, wenn man die Beschleunigung des Auseinanderstrebens einmal außer Acht läßt, zugeben müssen, daß die Folgerung des Urknalls aus der Beobachtung der Fluchtbewegung die Annahme impliziert, es wären die Gesetze der Physik schon immer so gewesen, wie sie jetzt (und hier) erscheinen; wenigstens müssten sie im Moment des Urknalls in ihrer jetzigen Form entstanden sein. Man extrapoliert auf den Urknall wie auf die Abschußeinrichtung eines seit Jahrmilliarden daher rasenden Projektils, unter der Annahme, es hätten von Anbeginn die heutigen Bewegungsgesetze gegolten.
Ich persönlich glaube das nicht. Ich meine, die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, haben sich entwickelt (und werden fortfahren, sich zu entwickeln); sie sehen nur aus, wie eherne Gesetze, weil sie im Bereich des Beobachtbaren konstant zu gelten scheinen. Deshalb dürfen wir sie getrost „Gesetze“ heissen. Ich haltejdeoch für unegal, über so unüberblickbar weite Zeitbereiche zurück zu extrapolieren wie bis zum Urknall und einfach die Immergültigkeit der Physik auf alle Zeiten/Orte anzunehmen, auch wenn ich zugebe, daß es die naheliegendste aller falschen Annahmen ist.
Im Grunde scheint uns in dieser Annahme wieder eine Art Gottes-Sehnsucht im Denken der Physiker auf, die Sehnsucht nämlich nach etwas Konstantem, Immergültigem, Verlässlichem.
Dabei weiß jeder, der die Natur einmal genauer angeschaut hat, daß in ihr nichts Bleibendes ist, nicht im Großen und nicht im Kleinen, nicht in Bovisten und nicht in Planeten, nicht in der Struktur und nicht in der Substanz, nicht im Wesen und nicht in der Erscheinung…
Entscheidend ist nun aber, daß selbst in dem Fall man meinen Glauben nicht teilt, es wären auch die Naturgesetze stets im Werden und Sich-Ändern begriffen, man eben darum wird zugeben müssen, daß die Frage nach der Erstbewegung in jedem Fall von Annahmen über die Gültigkeit der Naturgesetze begleitet werden muß – die man eben glauben kann, oder eben nicht. Die Frage nach der Erstbewegung bleibt eine des Glaubens.
Ich bin im Übrigen gern in der allgemeinen Aussage d’accord, daß eine Extrapolation auf unvordenkliche Zeiten irgendwann so unscharf werden muss, daß wir ihre Richtigkeit/Notwendigkeit nur durch Einforderung eines sehr starken Glaubens an die Randbedingungen beweisen können. So, wie es eine Unschärfe hin zu ganz kurzen Zeiten gibt, muss es eine hin zu ganz langen geben. Der Grund liegt beiläufig und sehr vereinfacht gesagt darin, daß wir eben Menschen sind und mit unseren Möglichkeiten den Maßstab jeder Bewegung vorgeben.
Das ist das eine. Das andere ist, daß es natürlich gar keinen Anfang gibt. Man kann immer fragen: Und was war davor? Was war vor dem Urknall? Was war vor der Schöpfung? Wer oder was hat den Urknall gemacht oder verursacht? Und was war davor…?
Viele Physiker sagen, es sei sinnlos diese Frage zu stellen, weil keine Information über ein etwaiges Vorher durch den Urknall hindurch transmittiert hätte werden können. Die Theologen sagen, es sei sinnlos diese Frage zu stellen, weil davor Gott war (bis zum Anbeginn aller Zeit…) und eine Welt ohne Welt sei für uns ohnehin nicht denkbar. – Auffällt, wie einig sich plötzlich alle Erstbegründer sind, daß es sich um den „Anbeginn der Zeit“ handeln muss, so daß Fragen nach dem „Davor“ per Definitionem unstatthaft werden. „Anbeginn der Zeit“ meint, wenn man es recht besieht, nichts anderes, als ein Verbot des Weiterfragens.
Man erkennt den Selbstwiderspruch der Rede vom ersten Grund. Man will Grund und Anfang zugleich; Gründe aber tragen in sich, keine Anfänge sein zu können. Einer selbst unverursachten Kraft (einem Anfang also), mangelt es per definitionem an Notwendigkeit; und wo keine Notwendigkeit ist, ist auch kein Grund. Gründe, mit anderen Worten, benötigen selbst immer zwingend eigener Gründe usw. ad. inf. Die Möglichkeit des Weiterfragens rührt nicht einfach nur aus einer Laune, sondern aus der Beschaffenheit dessen, was wir einen Grund nennen.
Das Weiterfragen ist eine sehr naiv-kindliche “Welt-Anschauung”. Man kennt es von Kleinkindern, wenn sie ihren Ursachentrieb entdecken und ungemeine Freude in ewigen „Warum?“-Frageketten finden. Ich räume ein, das muss keine Welt-Anschauung sein; genauso gut kann es die Entdeckung der ersten Möglichkeit sein, eine Konversation endlos lange fortzuspinnen… Wie dem auch sei, es kommt nach der Kindheit mit ihrer Fragelust im Leben des Menschen ein Moment der (unbewussten?) Entscheidung, wo er entweder akzeptiert, daß die Antworten auf das Warum immer phantastischer werden müssen, je weiter sie zurück reichen – Oder sich lieber entscheidet einen Erstgrund herzufabulieren.
Taugen, das wollte ich plausibel machen, würde jeder Erstgrund mit der selben Berechtigung. Jeder Anfang, dies zeigt bereits die Möglichkeit des steten Weiterfragens, ist eine willkürliche Setzung. Und was wäre eine willkürliche Setzung anderes, als Glaube?
Es sind die willkürlichen Setzungen, die der kindlichen Unbefangenheit abgewöhnt haben, immer weiter zu fragen. Das ist aber das Gegenteil von dem, was ich meine, wenn ich von von „Ausdifferenzzierung der in der kindlichen Seligkeit angelegten Begriffe“ spreche; es wäre doch vielmehr ihr Absterben. Ich befürworte ein Aufheben dieser kindlichen Neugier, nicht ihr Abspeisen mit Erstbewegern wie Gott oder Urknall.
Aufgehoben wird die Neugier in der Wissenschaft. Ich komme jetzt auf meine Laxheit zurück. Es liegt der unschätzbare Vorteil der Wissenschaft darin, dass sie in der Lage ist, ihre eigenen Dogmen zu verwerfen. Sie muß am Urknall nicht festhalten, wie es die Religion an Gott tun muss. Ihre Wahrheiten sind immer nur vorläufige; die Wahrheit Gottes aber kann den Anspruch auf Immergültigkeit nicht fallen lassen. Die Wissenschaft, mit anderen Worten, erhält die Freude am Weiterfragen, wo die Religion aus ihr einen Verdruss macht.
Das also meine ich: Wir dekonstruieren Gott, indem wir die Sehnsucht nach Erstbegründung in eine Freude am Überprüfen von Hypothesen verwandeln. Nicht der Urknall widerstreitet in Wirklichkeit mit der Schöpfungsgeschichte. Weder dies noch jenes können wir überprüfen; höchstens können wir die Annahmen überprüfen, die uns auf den Urknall leiten und sie mit jenen vergleichen, die uns auf die Schöpfung leiten.
Nein, im Kern widerstreiten hier zwei verschiedene Arten, mit dem Unwissen umzugehen: eine fröhlich-naive mit einer resigniert-naiven; die Wissenschaft mit dem Schöpfergott.
Die Wissenschaft ist die fröhlich-naive Art, eine Hypothese auf ihre Tragfähigkeit oder ihren Wirkbereich zu überprüfen. Zu Zeiten ihrer größten Wirksamkeit mag eine wissenschaftliche Hypothese fast wie ein kirchliches Dogma aussehen, aber die Wissenschaft ist in ihrer Seele, mit Paul Feyerabend zu reden, „anarchisch“; ihre geheime Freude besteht im Errichten von Lehrgebäuden, nur um sie nachher wieder einzureissen. Hierhin wird die Kindlichkeit aufgehoben; die des Weiterfragens, die des Sandburgenbauens und -einreissens, die der spielerischen Welt-Anschauung und abenteuerlichen Erkundung. Fast nebenbei wird man durch dieses Spektakel klüger.
Die Religion hingegen ist die resignativ-naive Art, eine Sache als geoffenbart zu nehmen; ihre Freiheit besteht nicht im Bezweifeln der Schöpfung, sondern beschränkt sich auf deren Auslegung. Auslegung ist natürlich viel weniger, als beispielsweise die ganze Urknalltheorie zu verwerfen, um dafür, ebenso vorläufig, irgendeine Wechselwirkung mit dunkler Materie zu setzen.
Warum ich immer „naiv“ sage? Nun, naiv sind beide Sichten so lange, wie sie einseitig bleiben. Die Naivität verschwindet erst in dem Moment, wo die Haltung gegen das Unwissen sowohl resignativ als auch freudvoll zugleich wird. Dann erst haben wir den ganzen Grund zu Demut gegen die Erkennbarkeit der Welt und zur Zuversicht, sie dennoch zu erkennen.
Es gab schon in der Kirche – zu Zeiten, als die Mutterzelle noch groß und eins war – immer diese beiden Strömungen. Es gab die dunkle Strömung, die ein Leben in Entsagung und Demut befürwortete, und es gab die helle Strömung, die Gottesbeweise aussann und über Gottes Natur spekulierte. Natürlich waren die Gottesbeweise nicht für die Überzeugung von Atheisten oder Agnostikern gedacht; es waren kluge, fromme Gedanken von Gläubigen für Gläubige.
Wozu sonst bewiese ein Gläubiger Gott? Wenn er Gott beweisen könnte, müsste er weder Glauben einfordern noch bekennen. Umgekehrt, wenn er an Gott schon fest glaubt, braucht er doch keinen Beweis mehr; welcher Beweis könnte noch stärkere Gewissheit herstellen, als ein fester Glaube? Nein, es ging in den Gottesbeweisen nie um den Beweis Gottes. Es ging stets darum, der Freude am Weiterfragen zu willfahren.
Genauso, nur mit umgekehrten Vorzeichen, bezwecken die Bibeltreuen und Wortgläubigen eben Resignation vor dem Weiterfragen. Es beängstigt sie, oder bedrückt sie, oder eröffnet vielleicht besagte Gottes-Leere, daß die Möglichkeit des Weiterfragens ohne Ende ist. Dann machen sie sich eben ein Ende.
Nicht an dieser Frage, erkennt man, hat sich die Mutterzelle gespalten. Die Trennung in Atheisten und Gottesgläubige ist nicht gleich auch die Trennung in Erstbegründer und Nicht-Erstbegründer. Es gibt sowohl unter Christen, als auch unter Wissenschaftlern solche, die ein Rätsel als Herausforderung annehmen und solche, die es als Bedrohung ablehnen. Ich kenne Christen, die nehmen die Schöpfung sehr gelassen und ich kenne Wissenschaftler, die auf dem Urknall beharren als hinge ihr Leben davon ab. Wäre die Frage nach der Erstbewegung so entscheidend, befänden sich diese Leute ja im falschen Club.
Soweit von der Dekonstruktion Gottes als Erstbeweger. Man muss sich entscheiden, ob man ein Freund oder ein Feind des Nichtwissens ist. Und dann muß man die Naivität hinter sich lassen, und beides zugleich sein…
Ich kann dies Kapitel nicht schliessen, ohne noch wenigstens in Kürze über die Begründung von Moral und gutem Handeln geschrieben zu haben. Es wird ja auch in dieser Frage wacker gestritten, ob Gott als letzter Grund angerufen werden müsse.
Die Religiösen sagen, alles moralische Handeln lasse sich nur im Hinblick auf Gott begründen; die Atheisten sind in der Wahl ihres Grundes nicht ganz entschieden. Wahlweise nehmen sie verhaltens-evolutionäre Konzepte her, oder gesellschaftsphilosophische; in jedem Fall verneinen sie, dass der Grund, aus dem der Mensch überhaupt eine Pflicht zum Wohlverhalten empfinden kann, von Gott kommen könne.
Was moralisch ist und was nicht, ist ohnehin kontingent. Die Frage ist nach der letzten Herkunft von Moral selbst und nicht nach ihrem konkreten Inhalt.
Nun mag ich mich nicht wiederholen, denn es treffen natürlich auch für diese Frage die oben gebrachten Argumente zu. Sie gelten ja ganz allgemein gegen jedwede Letztbegründung. Deswegen sage ich es nur kursorisch: Letztbegründung gibt es nicht; sie ist ein Widerspruch in sich. Entweder Begründung oder Letzt-, aber nicht beides. Letztbegründung ist im Grunde nur Kneifen vor der Möglichkeit des Weiterfragens und der Versuch, eine nie verlöschende Begründungs- und Rechtfertigungspflicht abzuschütteln. Selbstversändlich gilt das auch im Bereich der Moral; gerade in dem. Es gibt keine letztbegründete Moral, weder von Gott, noch von der Natur. Stattdessen gibt es eine stet sich erneuernde Rechtfertigungspflicht jeder Moral.
Wenn Moral nicht letztbegründbar ist, kann sie auch nicht evolutionär begründet werden. Der Mensch ist ohnehin das Tier, das sich schneller entwickelt, als sein Erbgut; er hat sich (qua Evolution des Werkzeugs) zu einem beträchtlichen Grad von der genetischen Evolution emanzipiert. Das heißt nicht, die genetische Evolution wäre beim Menschen zum Stillstand gelangt oder hörte auf zu wirken. Natürlich evoluiert auch der Mensch. Nur ist seine genetische Evolution mitlerweile viel langsamer als die Evolution des Werkzeugs und des Wissens.
Daraus folgt, daß der Mensch vermag, Dinge zu tun, die ganz und gar nicht im Sinne der genetischen Evolution sind und sich auch nicht evolutionär ausgeprägt haben können. Seine Möglichkeiten, sich zu verhalten, gehen weit über das hinaus, was in der genetischen Evolution positiv selektiert (=verbreitet) würde.
Unbestreitbar hat die Evolution ihm gewisse Möglichkeiten und Triebe mitgegeben. Was er in seiner Gesellschaft daraus macht, wie sehr er sich dieser evolutionären Mitgift bewußt werden kann, wie stark er sie nach seinem Willen formen kann und wiefern sie nur untergründig sich ausprägen, mag dahin stehen.
Fest steht jedoch, dass der Mensch die Rechtfertigung seines Handelns ungleich stärker aus seiner gesellschaftlichen Existenz schöpft, als aus seiner biologischen. Man denke an die Amazonen (falls es die je wirklich gab), man denke an die ein-Kind-Ehe in China, man denke an den Geburtenrückgang in den entwickelten Industrieländern. Das sind nur ein paar erratische Beispiele von Verhalten, das der Weitergabe und Verbreitung von Genen zuwider handelt; es gibt noch etliche andere: Selbstmorde, das Vermögen die eigene Art in einem Atomkrieg auszulöschen, Geburtenkontrolle etc. etc. Es ist weder möglich, noch überhaupt sinnvoll, dieses Spektrum der menschlichen Verhaltensmöglichkeiten aus seinen Genen zu begründen.
Interlude: Ob die Evolution etwas begründen kann
Ich schiebe an dieser Stelle eine kurze Betrachtung über Gründe ein. Das Kapitel handelt im Wesentlichen über die modale Struktur der Evolutionslehre und kann von weniger Interessierten auch übersprungen werden. Aber weil das Thema fast unweigerlich ins Spiel kommt, wenn über Gott debattiert wird, habe ich mich entschlossen, es dennoch in diesem Aufsatz zu bringen.
Es eignet sich die Evolution – sei es der Gene oder des Werkzeugs – nämlich streng genommen für überhaupt keine Art der Begründung. In der Art, wie sie Zufall und Notwendigkeit miteinander verknüpft, liegt zwar ihre eigentliche Genialität, aber eben auch ihre Begründungs-Schwäche.
Evolution ist eine durchaus komplizierte Theorie. Hier ist nicht der Ort, sie im Einzelnen zu erläutern, aber es verlohnt ungemein, über sie nachzudenken. Ich ermuntere jeden, der sich einmal in diese Absätze verirrt hat, die klassischen Werke von Monod, Eigen und Dawkins zu lesen.
Grob gesagt besagt die Evolution, daß es zwei Prozesse gibt, deren Ineinandergreifen die Fortentwicklung der Natur bewirken: Einen Generator- und einen Stabilisator-Prozess.
Der Generator-Prozess bringt unaufhörlich Varianten und Neuheiten in die Welt, er generiert eben Vielfalt, daher sein Name. Dem Generator-Prozeß nachgeschaltet ist der Stabilisator-Prozess. Er wählt dann unter dieser Vielfalt aus, weswegen er unter dem Namen „Selektion“ bekannt geworden ist. Aber diese Bezeichnung ist irreführend. Selektion klingt nach einer Art „Naturverstand“, der zwischen sinnvollen und sinnlosen Varianten unterscheidet; nur ist in der Natur kein Sinn, keiner jedenfalls, dessen die Evolution bedürfte. Selektion meint denn auch in Wirklichkeit nur die Lebensdauer bzw. Stabilität einer Variante. Wie diese Stabilität im Einzelnen sich erzeugt und auf welcher Zeitskala wir eine Variante als „stabil“ ansehen, mja selbst, was „stabil“ im engeren Sinne bedeutet, muss in unseren Zusammenhängen nicht weiter kümmern.
Wir können nämlich bereits mit der groben Kenntnis beider Prozesse die Frage beantworten, ob der Mechanismus der Evolution verwendet werden kann, um etwas zu begründen (zB. Moral)? Man sieht, daß die Frage nach dem Herkommen einer Sache – aka nach ihrem Grund – in der Evolution auf den Generator-Prozess verweist, denn dort entsteht alles Neue. Der Stabilisator-Prozeß bewirkt nur, daß unter den generierten Varianten stabile und weniger stabile sich befinden, aber er bringt selbst nichts hervor. Wenn also irgendeine begründende Kraft in der Evolution liegen soll, muss sie aus dem Generator-Prozess kommen.
Nun verhält es sich aber so, daß die Evolution eben von diesem Prozess sagt, er sei zufällig. Varianten, heisst es in der klassischen Evolutionslehre, entstehen als zufällige Mutationen. Zufall hinwieder bedeutet ohne Notwendigkeit. Das heisst, genau dort, wo die Evolution wirklich etwas begründen könnte, hört ihre Zuständigkeit auch schon wieder auf!
Man kann es auch in den Worten von Zufall und Notwendigkeit ausdrücken. Ein Grund ist immer die Behauptung der Notwendigkeit einer Abfolge. „Dies verursacht jenes“ bedeutet: Weil dies eingetreten ist, musste notwendig jenes geschehen. In der Evolution nun wird ein zufälliger Prozess (Generator) einem notwendigen Prozess (Stabilisator) verbunden. Nach den elementaren Regeln der Modallogik folgt daraus, dass in der Evolution alles Bestehende möglich, aber nichts notwendig ist.
Es ist dies der Grund, daß wir den Fortgang evoluierender Gegenstände nicht voraus sagen können; weder den der Gene, noch den des Werkzeugs. Die Evolution hat, im Gegensatz zu anderen naturwissenschaftlichen Theorien, keine Voraussagekraft. Das Licht der Evolution ist stets ein Rücklicht: Es erhellt die Dinge immer erst im Nachhinein; was ihr an erklärenden Tendenzen inne wohnt, wirkt immer nur retrospektiv. Sie sagt von allen vorhandenen Dingen lediglich aus, daß nichts gegen sie spricht; ihre Notwendigkeit, wie gesagt, kann sie nicht beweisen.
Der Fehler wird allgemein (auch von Wissenschaftlern) begangen, das Vorkommen von Dingen mit dem Stabilisator-Prozess zu begründen. Wie man nun sieht, ist das eine Tautologie und keine Begründung. Eine Sache existiert, weil sie stabil ist und sie ist stabil, weil sie existiert. Den Grund einer Sache weist das letztlich nicht; es ist nur eine elaborierte Art, ihr Vorkommen zu bekräftigen.
Im Übrigen ist das oben gesagte eine starke Vereinfachung. Der Generator-Prozess ist nicht rein zufällig; genauso wenig, wie die verschiedenen Stabilisator-Prozesse notwendig sind. Es gibt zum Beipiel Varianten, die nicht durch Mutation, sondern durch Kombination entstehen. Kombination ist nicht zufällig, oder doch in der Regel weit weniger, als herkömmliche Mutationen. Gerade in der Entwicklung des Werkzeugs spielt sie eine maßgebliche Rolle. Auf der anderen Seite kann es Zufälle geben, die zu ganz anderen Stabilisator-Prozessen führen; zum Beispiel der Einschlag eines Asteroiden. Deswegen mag es Einzelfälle geben, in denen wir aus der Evolution dennoch Gründe ableiten können. In der Regel ist das immer dann der Fall, wenn wir den Generator-Prozess genauer beschreiben können, d.h. eine mechanistische Beschreibung für ihn zur Hand haben, die ohne Zufall auskommt.
Fortsetzung: Erstbegründung von Moral
Das Hernehmen und Geltenlassen von Gründen ist, wie man unterdessen wahrscheinlich ahnt, eine durchaus verwickelte Sache. Jeder Grund hat einen Zusammenhang, dem er entnommen sein will, damit wir ihn gelten lassen. Es ist nicht damit abgemacht, „Gott“ zu sagen, um einen Grund zu geben, oder „Evolution“ oder „Natur“. Ich habe zwar nicht vor, alle Kriterien zu geben, die ein Grund erfüllen muß, aber es liegt auf der Hand, daß er einerseits immer etwas ausserhalb des Begründeten liegen soll – sonst wäre er eine Tautologie – aber nie so weit von ihm entfernt, dass uns der Mechanismus seines Wirkens spukhaft vorkommen muss.
Moral, um endlich zu der zurück zu kehren, lässt sich deshalb nur mit Begriffen begründen, die wenigstens zum größten Teil aus der Sphäre menschlichen Verhaltens herstammen. Manche Aspekte von Moral mögen in unsere rein biologische Existenz hinein reichen, gewiss auch reichen manche ihrer Würzelchen bis in unsere chemische und physikalischen Natur. Aber wie wollte man in der Sprache der Elektronen und Superstrings einen moralischen Soll-Satz auch nur aussprechen, geschweige denn begründen? Und selbst wenn es möglich wäre – wozu? Es ist einmal unsere Forderung an einen guten Grund, dass er einleuchten soll.
Moral betrifft den gesellschaftichen Umgang der Menschen miteinander. Ergo muss, wer einleuchtende Gründe der Moral will, zurück zu den frühen menschlichen Gesellschaften. Was davor war, kann, das wollte ich weisen, als Grund nur sehr eingeschränkt gelten. Gewiss hat die Moral eine Vorgeschichte. Aber es ist eben nur die Vorgeschichte und nicht ihre Geschichte.
Meines Erachtens erkundigt sich die Frage nach dem Grund von Moral nach der Entstehung von Kultur und Erziehung. So verstehe ich die Frage, so leuchtet mir das Problem ein. Dort, in den Anfängen menschlicher Vergesellschaftung, in den Anfängen der Arbeit und des Sprachvermögens liegen ihre hauptsächlichen Gründe, nicht in der Evolution; und auch nicht in der – göttlichen oder psychischen oder neuronalen – Beschaffenheit der menschlichen Seele.
Spiegelneuronen, heisst das, begründen nichts, sondern *beschreiben* die selbe Sache nur auf einer niederen Ebene. Es ist den Neurophysiologen gelungen, einen Aspekt der Moral im Gehirn wiederzufinden. Die Leistung ist beachtlich und der Fund durchaus befriedigend. Aber die Interpretation dieser neurophysiologischen Phänomene, das Deuten ihrer Funktion entnehmen wir nach wie vor der Sphäre des menschlichen Miteinanders. Ohne selbst moralische Wesen zu sein hätten wir weder die Funktion der Spiegelneurone in der Weise interpretiert, wie wir es nun tun, noch überhaupt erst nach ihnen gefahndet. Es setzt, mit anderen Worten, die Entdeckung der Empathie-Neuronen bereits unsere Empathie-Erfahrung voraus; ergo kann diese Entdeckung nicht als Grund gelten.
Kultur und Erziehung, kehre ich also zurück, sind die wahren Erklärungszusammenhänge von Moral. Mit Kultur und Erziehung hat der Mensch mächtige Werkzeuge geschaffen, seine Triebe einzudämmen und sie zum Gegenstand rationaler Erwägungen zu machen. In dieser Rationalisierung (und also auch Versprachlichung) von Trieben und Handlungsimpulsen würde ich den Anfang von Moral erblicken.
Es kann durchaus sein, daß das alles nur Selbstbetrug und Sublimation ist. Auch wenn es mir gar nicht in den Kram passt, mag sein, Freud hat recht. Es kann auch sein, zwischen uns und dem Tier in uns ist lediglich eine dünne, nicht sehr feste Trennschicht. Eine Tapete nur, eine durchsichtige Folie. Das alles lasse ich hier hingehn, denn es zielt ja nicht auf die Herkunftsgründe der Moral.
Von denen meine ich, dass sie mit der Entstehung der Gesellschaft, und also auch der Entstehung der Arbeit zusammen hängen. Arbeit verstehe ich, sehr knapp und abstrakt gesagt, als Aufteilung des Stoffwechsels innerhalb einer Art; zur spezifisch menschlichen Arbeit bedarf es dann noch des Hinzutretens des Werkzeugs. Sobald diese Dinge in der Welt waren, wurden sie von der Entwicklung von Sprache und Kultur begleitet.
Die unterschiedlichen Arbeiten können nur Arbeit sein, wenn sie sich aufeinander beziehen, das heisst einander notwendig benötigen. Das wiederum ist nur möglich, wenn die Arbeitenden sich an bestimmte Regeln halten. Sobald diese Regeln nicht mehr durch die Gene bestimmt werden (wie noch bei der Arbeitsteilung der Ameisen oder Bienen), müssen sie von woanders herkommen. So denke ich mir, sehr einfach skizziert, die Notwendigkeit des Entstehens – den Grund – von Moral. Es ist übrigens in den selben Zusammenhängen, in denen ich mir das Aufkommen der Götter denke.
Natürlich ist das alles extrem spekulativ. Aber abgesehen davon, dass ich mich ausserstande sehe, diese Fühzeit-Untersuchungen in befriedigender Weise durchzuführen, wären sie an diesem Ort auch ganz deplaciert. Hier war ja nur erfordert, anzugeben, welche Art von Gründen für das Vorkommen von Moral ich überhaupt akzeptieren würde. Natürlich, es würden keine Erstgründe sein, aber sie würden mir das Herkommen und den Inhalt moralischer Handlungsgründe doch beträchtlich erhellen.
Das davon, wie Gott als Erstgrund von Moral aufgehoben werden kann. Es ist, wie alles gebrachte, nur ein Vorschlag.
Substanz & Transzendenz
Substanz und Transzendenz müssen sich ein Kapitel teilen, weil mir zu beidem weniger einfällt, als zu Trost und Erstbegründung.
Mit Substanz, das hatten wir einleitend, meine ich eine Gegebenheit der Dinge jenseits von Sprache und analytischem Denken, aber trotzdem im Geist; man kann sagen: im fühlenden Geist. Alle Dinge haben ja eine Art, sich anzufühlen; ergo hätte alles Substanz.
Ob Substanz eine von der Wahrnehmung unabhängige Existenz zukommt, ist eine philosophische Frage, deren Beantwortung ich in einem gesonderten Aufsatz zur „Philosophie des Lebens“ plane. Hier beschäftigt uns allein, wozu wir den Substanzbegriff überhaupt benötigen?
Das lässt sich am besten an einem Beispiel verdeutlichen; es ist ein vielgegebenes Beispiel und stammt nicht von mir: Wasser, das weiss jedes Kind, hat als Molekül die Formel H2O, es handelt sich chemisch also um Wasserstoffoxid. Natürlich können wir keine einzelnen Molekül wahrnehmen; wir kennen jeden Stoff nur als Ansammlung einer gewaltigen Anzahl von Molekülen. Deswegen muss man, wenn man über die uns bekannte „Substanz“ Wasser sprechen will, die kondensierte flüssigen Phase betrachten, zu der nicht allein die Zusammensetzung und Struktur des Einzelmoleküls gehört, sondern auch die Verknüpfung vieler Moleküle zur Flüssigkeit, die, beiläufig, im Fall von Wasser extrem komplex ist. Es entstehen Molekülcluster von fluktuierender Gestalt; zwischen ihnen werden Protonen und Wassermoleküle ausgetauscht, das ganze wandelt und wabert vor sich hin, bildet vorübergehende Formen und Strukturen und ist, wie gesagt, auf der mesoskopischen Größenskala ausserordentlich wechselgestaltig.
Dies teilt uns die Wissenschaft über das Wasser mit. Aber kann sie uns auch sagen, dass Wasser sich nass anfühlt?
Sie kann es nicht. Nicht alle Flüssigkeiten fühlen sich nass an; Dimethylsulfoxid zum Beipiel merkt man fast gar nicht, wenn es die Haut netzt. Die Nässe des Wassers ist eine Eigenschaft, die sich weder in seinen Bestandteilen, noch in seiner Struktur findet. Dennoch gehört Nässe unleugbar zu des Wassers Gegebenheit im fühlenden Geist.
Hier kommt der Substanzbegriff ins Spiel. Der Substanzbegriff, sieht man am Wasser-Beispiel recht schön, hilft unsere Vertrautheit mit der Welt begründen.
Ich komme gleich auf die Vertrautheit. Zuvor will ich jenen antworten, in deren Innern es gerade ruft: Aber die Nässe des Wassers kann von der Wissenschaft durchaus beschrieben werden! Man müsse eben die Art der Wahrnehmung des Wassers in die wissenschaftliche Beschreibung mit hinein nehmen! Möglicherweise könne „Nässe“ dann auf eine gewisse Dichte und Anordnung von Wasserstoffbrücken zu unseren Sinneszellen zurück geführt werden.
Diesem Einwand sei zunächst statt gegeben. Wahrscheinlich entsteht Nässe auf diese Weise. Nur: Wollen wir nicht eigentlich, daß Nässe eine Eigenschaft des Wassers ist anstatt eine Empfindung, die aus Wechselwirkung der Wasserstruktur mit unseren Sinnen entsteht?
Ich gebe noch ein Beispiel: Unser Farbempfinden. Wir wissen, die Farbe grün entspricht dem Spektralbereich um ca. 500nm; aber natürlich *sind* elektromagnetische Schwingungen von 500nm nicht grün. Genausowenig sind Noten identisch mit Musik. Die Geschwindigkeitsverteilung von Molekülen ist nicht die Empfindung heiss oder kalt. Und so weiter.
Man sieht, daß wir ständig der Welt Eigenschaften zuschreiben, die in ihrer wissenschaftlichen Beschreibung nicht vorkommen, bzw. von deren zutreffender Beschreibung wir fordern müssten, dass sie unseren Wahrnehmungsapparat mit einbeziehen.
Nun verhält es sich aber so, daß auch der Einbezug unseres Wahrnehmungsapparates und letztlich unseres Hirns nicht einfach dazu führen würden, dass wir mentale Inhalte wie „nass“ oder „rot“ oder „Musik“ oder „heiss“ finden. Auch Wasserstoffbrückenbindungen zu unseren Sinneszellen sind ja nicht das selbe wie „nass“, wenngleich sie die Ursache dieser Empfindung durchaus sein können. Aber es bleiben doch ersteinmal Wasserstoffbrückenbindungen oder Neurotransmitter oder Muster von feuernden Neuronen.
Bestenfalls entdecken wir beim Hinzunehmen unseres Wahrnehmungsapparates ein „neuronales Korrelat“, eine Wortschöpfung der Neurophysiologen, die das Leib/Seele-Problem gern umgehen wollen. Woran sie mit Mühe stets vorbei schielen, ist die einfache Tatsache, dass mentale Inhalte durch Zergliederung und äussere Examination eines Lebewesens nicht findbar werden. Ich weiss nicht, ob man daraus schliessen kann, sie wären überhaupt nicht vorhanden. Mir leuchtet jedenfalls ein, wenn die meisten Menschen sich nicht nehmen lassen wollen, dass es mentale Inhalte gibt. Zu unmittelbar scheinen die Empfindungen, die sie beim Erfahren der Welt erleben, als dass sie für Trug und Einbildung erklärt werden könnten. Selbst aber, wenn sie Trug wären: Was wäre dieser Trug? Wo ist seine materielle Entsprechung?
Natürlich können wir das Leib/Seele-Problem an dieser Stelle nicht behandeln. Aber wir verstehen schon, wozu wir den Substanz-Begriff benötigen. Er überbrückt die Lücke zwischen der wissenschaftlichen (d.i. strukturellen) Beschreibung einer Sache und ihrer Gegebenheit als mentaler Inhalt. Er sagt, jede Sache hat eine Art sich anzufühlen; dies sei die (Erfahrung seiner) Substanz.
Was hat das nun mit Gott zu tun? Ich komme auf den Begriff „Vertrautheit“ zurück. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir aus elektromagnetischen Schwingungen so eine angenehme Empfindung wie Farbe gewinnen können, oder aus Schwankungen des Luftdrucks den Genuss von Musik. Dass uns die Welt nicht wie ein sinnloser Haufen von Sonnen und Nebeln, von Molekülen und Feldern und Schwingungen etc. erscheint – dass letztlich in ihr überhaupt „etwas“ vorkommt – das liegt, sagen die Theologen, an der Substantialität der Welt. Gott hat sie so hergestellt, dass wir sie sinnvoll erfahren können, indem er sie aus Substanz gemacht hat. Er hat sie uns, bei all ihrer seltsamen inneren Beschaffenheit: anvertraut. Wir können sie annehmen und erkennen, wie können sie sogar mögen und ohne ständige Furcht und Verwirrung in ihr leben. Gott selbst ist dabei die substantiellste aller Substanzen, die Substanz, aufgrund derer jede andere Substanz nur sein kann.
Interlude#2: Vom Stufengang der Wahrnehmungen
Man sieht schon, dass diese Ideen eng mit Gott als Erstbeweger verknüpft sind (aber davon nicht nocheinmal). Man sieht auch, dass sie verworren sind.
Ich würde gern entwirren. Zuerst kommt es mir unnötig vor, zwischen Erfahrung und Substanz zu trennen. Das sagte ich bereits. Der Unterschied, der zwischen beiden gemacht wird, ist eigentlich eine Doppelung; wir können sie vermeiden, wenn wir von dem Begriff „Wahrnehmung“ Gebrauch machen.
Wahrnehmung ist eine Art Abbildung der Wirklichkeit im Innern eines Lebewesens, wobei die Abbildung nur bestimmte Aspekte der Wirklichkeit nachbildet. Nachbildung darf man nicht wörtlich nehmen, etwa im Sinne einer photographischen Abbildung oder einer Tonaufzeichnung; es hat eher was mit Übersetzung einer fremden in eine bekannte Sprache zu tun. Für ein genaueres Verständnis von Wahrnehmung müsste ich den Informations-Begriff bemühen, was aber nur eine ganz unnütze Erläuterungsblase erzeugen würde. Für unseren Zweck, von Gott und Substanz zu reden, können wir einstweilen mit einem sehr ungefähren Wahrnehmungsbegriff – Wahrnehmung als Übersetzung – zufrieden sein und arbeiten.
Beim Menschen stelle ich mir den Übersetzungsprozess des Wahrnehmens, blumig gesprochen, so vor, dass zunächst in seinem Gedächtnis eine Menge Sinn-Knospen schlummern, die eine adaptive Basis der Wahrnehmung bilden. Das ist sozusagen das Vokabular der Sprache, in die übersetzt wird. Beim Erleben der Welt werden diese Knospen nun durch äussere Reize in unterschiedlichen Kombinationen zum Blühen gebracht. Dieses Erblühen wiederum ist nichts anderes als das innere Nachschaffen der Welt aus Sinn-Zusammenhängen, die wir zu grossen Stücken bereits kennen. Jedes Erblühen hat dann eine eigene Art, sich anzufühlen; das Sich-Anfühlen des inneren Nachschaffens aber ist Erfahrung. Abstrakter und knapper gesagt, Erfahrung ist Wahrnehmung von Wahrnehmung.
Obwohl es für das fernere Entwickeln meines Gedankens nicht notwendig ist, will ich an dieser Stelle anmerken, dass ich nicht ohne Absicht von Wahrnehmung als von einem (nach)schaffenden Prozess rede. Damit soll zumindest angedeutet sein, daß jedwedes Wahrnehmen ein aktiver Prozeß ist, was im Wort „widerspiegeln“ nur unzeureichend angedeutet sich findet. Wahrnehmung bedarf der Triebkraft einer Situation, die bewältigt werden will; Wahrnehmung hat auf Seite des Subjektes immer das Bewältigenwollen von Situationen zur Voraussetzung (andernfalls es gar kein Subjekt wäre) und soll deshalb keinesfalls, selbst wenn das Bewältigenwollen nur als dumpfer Drang empfunden wird, als passive physikalische oder chemische Umwandlung verstanden sein.
Gut. Bis hier können wir des Substanzbegriffs entbehren. Aber *was* ist es, das wir erfahren? Wieso macht unser doppeltes Wahrnehmen/Nachschaffen aus dem wirren Gebraus der Welt „etwas“?
Im Prinzip ist die Frage schon beantwortet. Ich gebe einen, eingestanden sehr spekulativen Mechanismus des Hereinnehmens von Wirklichkeit durch einen Stufengang der Wahrnehmung und ihre damit einher gehende Aufladung mit Sinn. Wenn ich „Wahrnehmung von Wahrnehmung“ gesagt habe, bedeutet das mindestens zwei Stufen der Wahrnehmung; es können aber auch, das müssten die Hirnphysiologen heraus finden, drei oder zwanzig Stufen sein. Die jeweils nachgeschaltete Wahrnehmungsstufe rezipiert die Blütenmuster der ihr vorgeschalteten Wahrnehmung. Dadurch ergibt sich ein Mechanismus des „Durchreichens“ einer Wahrnehmung in immer innere und gleichzeitig auch immer abstraktere Sphären des Geistes; irgendwo auf diesem Weg nach innen (und oben) tauchen auch Symbole und Sprachlichkeit auf.
Ich weiss nicht, ob das Geschriebene klar genug war. Manchmal nützt es, zu paraphrasieren. Man muss, wollte ich bedeuten, nur eine Struktur des Wahrnehmungsapparates annehmen, die hierarchisch aufgebaut ist und zwar dergestalt, dass das Resultat einer Hierarchie-Stufe der Wahrnehmung immer das Substrat für die anfolgende, höhere Wahrnehmungs-Stufe bildet. Wahrnehmung ist dabei nicht als einfache Transformation oder Filterung eines einfallenden Reizes gemeint; beim Menschen ist der Reiz eher Auslöser einer wirklichkeits-nachschaffenden Tätigkeit des Geistes.
Als Material dieser Tätigkeit dienen Sinn-Bausteine, die wir in unserem Gedächtnis bereit halten. Jede Erfahrung, wenn sie nur intensiv genug ist, kann ihrerseits im Gedächtnis gespeichert werden und später als eigener Sinn-Baustein fungieren. Diese Tatsache beantwortet auch die Frage nach der ersten Herkunft unserer Sinn-Bausteine bzw. Wahrnehmungs-Basis. Unser Hirn stellt sie ersteinmal her. Einfach so. Anfänglich haben sie noch keinen klaren Sinn. Durch vielfachen Gebrauch aber laden sie sich mit Situations- und Handlungszusammenhängen auf; sie differenzieren sich, werden Symbolen und Lauten zugeordnet und gewinnen letztlich an Sinn. Es ist letztlich eine Adaption unseres Geistes an die Begegnungen, die er mit der Wirklichkeit hat.
Ich komme zur Nutzanwendung des Ganzen. Es spielt nun nämlich gar keine Rolle, ob der Mechanismus unseres Wahrnehmungsapparates tatsächlich in der skizzierten Weise funktioniert. Es reicht bereits, daß er denkbar ist. Ankam es nur darauf, nachzuweisen, daß wir Gottes nicht benötigen, um unsere Vertrautheit der Welt zu begründen. Es gibt, wollte ich sagen, eine Klasse von Theorien (Wahrnehmungstheorien), mit deren Hilfe plausibilisert werden kann, dass sich aus dem wirren Gebraus der Moleküle „etwas“ gewinnen lässt (auch die Moleküle selbst); dass Wasser nass sein kann und elektromagnetische Wellen grün. Die Existenz und prinzipielle Intelligibelität solcher Theorien kurz anzudeuten, darauf kam es an.
Jetzt kann ich auch zugeben, dass mir die Idee selbst nicht ganz geheuer ist, alles aus der hierarchischen Struktur unseres Wahrnehmungsapparates zu begründen, welche, gepaart mit unserem Gedächtnis die krause Wirklichkeit in Erfahrungen verwandelt. In der Konsequenz wäre ja die Wirklichkeit gänzlich substanzlos. Alles ist dann nur noch Struktur. Vertrautheit und Substanz wären nur eine seltsame Art der Wirklichkeit, auf sich selbst zurück gefaltet zu sein. So ein Verschwinden oder Aufgehen der Substanz in Struktur kommt mir eigentlich selbst komisch vor. Wenn man Struktur sagt, fragt man doch immer unwillkürlich, Struktur wovon? Struktur scheint ohne Substanz nicht denkbar. Aber vielleicht ist das eben nur eine Folge der Gegebenheit aller Dinge in unserem stets fühlenden Geist; vielleicht löst sich die Wirklichkeit tatsächlich in Struktur und Information auf.
Wie dem auch sei. Es reicht für meine Absicht, gezeigt zu haben, dass Theorien denkbar sind, mögen sie nun zutreffen oder nicht, die uns die Substantialität der Welt ganz ohne Gott und vielleicht sogar ganz ohne Substanz erklären können.
Fortsetzung: Substanz und Transzendenz
Kommen wir noch zur Transzendenz. Wie der Substanz-Begriff ins Innere des Menschen weist, weist der Transzendenz-Begriff aus ihm heraus. In gewisser Weise ist Substanz eher das Komplement zu Transzendenz, als Immanenz. Substanz soll das Hereinkommen der Welt in den Menschen erklären und Transzendenz das Herauskommen des Menschen in die Welt.
Dabei geht es diesmal weniger um Vertrautheit, als um das Aufgehobensein des Menschen in der Welt. Das betrifft unter anderem seine Sehnsucht, dass er nicht in seinen Körper eingeschlossen sei und in ihm seine absolute Grenze fände. Stattdessen möchte er über diese Grenze hinaus reichen. Nicht allein vermöge seiner Sinne, die ihn weiter sehen oder hören lassen, als sein Leib reicht, sondern anders, unsinnlich, allgemein und umfassend will er über sich hinaus ragen; will er vielleicht auch Teil einer Sache sein, die größer ist, als er selbst; will er vielleicht sogar dieser grösseren Sache dienen und sich ihr unterwerfen.
Vielfach zielt Transzendenz auf den Ort der Ideale. Transzendenz will dahin, wo die platonischen Gestalten hausen.
Natürlich kann man sagen, sie hausen in unserer Vorstellung, und die wiederum hat ihren Sitz im Gehirn. Mag sein. Aber das erklärt nicht die idealschaffende Tätigkeit des Geistes. Warum kann der Mensch jede vorkommende irdische Form in ein Ideal überhöhen, das die Wirklichkeit übersteigt? Keines seiner Ideale hat er je gesehen; es ist ja, im Gegenteil, die Eigenheit jedes Ideals, vollkommener zu sein, als alle Annäherungsversuche, welche die Wirklichkeit unternimmt. Woher nimmt er also seine Vorstellungen von Vollkommenheit, wenn nicht durch Teilhabe an Gott?
Nicht allein das Paradies oder das Jenseits sind transzendente Orte, es sind letztlich alle absoluten Prinzipien transzendent, genauso, wie alle Ideale, alle wirklichkeitsüberschreitenden Vorstellungen, von denen wir trotz ihrer Unwirklichkeit eine Ahnung haben und die deshalb trotz ihrer Unwirklichkeit wirken.
Die Frage wird oft gestellt, warum der Mensch ohne Ideale nicht leben könne; nicht jedenfalls, ohne wesentlich sein Menschsein preis zu geben? Weshalb kommt uns ein Leben ohne Ideale leer vor; weswegen und woher schafft unser Geist ständig neue Maßgaben der Vollkommenheit? Ist es nicht vielleicht doch Gott, der uns mit diesen Ahnungen erleuchtet und unserem Leben einen Sinn und einen Maßstab gibt?
Mir kommt das übertrieben vor. Kann nicht sein, Transzendenz ist nur eine Folge der Fähigkeit des menschlichen Geistes, Urteile zu fällen? Urteil, das meint den Vergleich mit einer vorgestellten Sache; oft eben mit einer Sache, an der man sich die Nachteile der wirklichen Sache fort wünscht.
Jetzt könnte man weiterfragen, woher wir die Fähigkeit nehmen, uns eine Sache abzüglich ihrer Nachteile vorzustellen und als wünschenswert zu erachten? Aber genauso gut können wir fragen, woher wir die Fähigkeit zur Abstraktion nehmen, oder die Fähigkeit, ein Einhorn zu denken? Benötigen wir für diese Fähigkeiten, ideale Gegenstände zu erschaffen, tatsächlich Gottes? Ist die Eigenheit des Geistes, Vorstellungen zu kreieren und in Vergleich zur Wirklichkeit zu setzen, so erstaunlich, dass wir dieses Reich der Vorstellungen hypostasieren müssen und mit ihm seinen Schöpfer und Herrscher?
Überhaupt ist ja fraglich, wie vollkommen unsere Ideale tatsächlich sind. Sind sie nicht, bei Tage besehen, genauso unvollkommen, wie die Wirklichkeit aus der wir sie extrapolieren? Sicher, weil es Unvollkommenheiten des Geistes sind, ist ihre Form sehr viel glatter und idealer, als die Formen der Wirklichkeit, aber schliesslich bleiben sie begreifbar und sowohl im Horizont unserer Wünsche als auch im Horizont des Sagbaren.
Das Vollkommene ist eben doch nur so vollkommen, wie wir es uns gerade noch denken können; das Erhabene nur so erhaben, wie unsere Fähigkeit zur Würdigung des Erhabenen reicht. Das Transzendente, meine ich, überschreitet uns vielleicht weniger, als wir es gern hätten. Es überschreitet möglicherweise nicht einmal unsere Erfahrung, denn die Vorstellung von etwas Vollkommenem gehört ja doch zu unseren Erfahrungen. Die Verheissung und vorgefühlte Beglückung, die mit dieser Vorstellung einher gehen, sind uns bereits vertraut.
Ich will der Transzendenz nun aber keine vollkommene Absage erteilen. Ich verstehe die Notwendigkeit des Herausweisens aus der Welt des Vorhandenen, Gegebenen, Irdischen. Ich würde nur die Richtung und das Gebiet, das sie weisen will, gern anders einordnen. Mein Vorschlag ist, daß Transzendenz ein elaborierter Ausdruck für unsere allgemeine Fähigkeit zur Sehnsucht ist. Sehnen ist das Gefühl, das den Gedanken an Transzendenz immer irgendwie begleitet.
Es gibt ja die Sehnsucht, die auf etwas konkretes sich richtet und dessen Eintreffen wünscht. Die meine ich nur ungefähr. Daneben gibt es aber auch eine Sehnsucht, die ganz allgemein ist. Sehnen eben. Davon rede ich.
Denn dieses allgemeine Sehnen vollzieht genau die Richtung der Transzendenz, es meint eine nicht vollständige Anwesenheit in einer Situation, sondern das gleichzeitige Verweisen in andere Situationen und Sphären; es ist sozusagen die Gefühlsentsprechung zweier Tatsachen, die in jeder Situation sich neben ihrem konkreten Inhalt mitereignet: Nämlich erstens, dass die Situation stets eingebettet in einen Strom von Situationen vorkommt (dessen Verlauf allerdings von der jeweils statthabenden Situation beeinflusst wird); dass mithin keine Situation isoliert ist, sondern jede Situation gleichzeitig aus sich hinaus weist. Und zweitens, dass jede Situation immer viele Möglichkeiten hat, auszugehen (von denen uns meist nicht alle gleich wünschenswert erscheinen); wir aber mit jeder Konkretisierung einer Situation die dadurch ersterbenden und neu sich eröffnenden Möglichkeiten mitfühlen.
Das alles ist im Sehnen schon erfühlt und meint nichts anderes als ein „Überschreiten“ der Wirklichkeit und des Subjektes. Ein Überschreiten aber, das, wie wir nun erkennen, ganz real ist, so real wie die Möglichkeiten der Welt, fortzuschreiten, tatsächlich existieren.
Schluss
Soweit, so vorläufig von der Dekonstruktion Gottes. Im Grunde enthält diese Niederschrift keinen einzigen neuen Gedanken (mit Ausnahme vielleicht des Kapitels über die modale Struktur der Evolutionstheorie). Ich habe sie denn auch sozusagen aus dem Stegreif verfasst, das heisst ohne Recherche, ohne genauen Plan, sogar ohne besondere Erkenntnisabsicht.
Meine Intention war nicht, neue Argumente gegen die Existenz Gottes zu bringen. Mir fiele auch gar kein neues Argument ein. Auch käme mir das ganze Vorhaben töricht vor. Es wäre natürlich bedeutend schwieriger, Gottes Existenz zu widerlegen, als es bereits schwierig ist, sie zu beweisen. Denn es geht wohl noch gerade, sich auf Merkmale zu einigen, welche die Existenz einer Sache zweifelsfrei anzeigen; aber es will mir ganz unmöglich scheinen, allgemeine Bedingungen zu stipulieren, welche die Nicht-Existenz einer Sache anzeigen. Wenn schon der Beweis Gottes nicht gelungen ist, wie sollte dann der Gegenbeweis glücken?
Ich hätte gern, dass man mir glaubt, dass ich einen Gläubigen gern an Gott glauben lasse. Ich möchte nur mit ihm reden und intellektuell redlich streiten können. Die Beschäftigung mit Gott ist ja auch für Atheisten lehrreich. So wie der Gläubige die Gründe seines Glaubens, soll ja auch der Atheist die Gründe seines Nicht-Glaubens versuchen.
Im Übrigen ist hoffentlich aufgefallen, dass das Wort „Spiritualität“ nicht ein einziges mal gefallen ist. Es wird ja, wenn von den Gründen des Gottesglauben die Rede geht, nicht selten ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen nach Spiritualität ins Spiel gebracht. Ich mag das Wort nicht.
Es muss doch auch aus der Sicht eines Christen verkleinernd sein, von Gott als Gegenstand eines Bedürfnisses zu reden. Ich kann ihnen nur beipflichten. Im Lichte der besprochenen Richtungen, in die Gott mindestens weist – Trost, Erstbegründung, Substanz, Transzendenz – wäre es wirklich schmählich, ihn allein zum Gegenstand des Bedürfnisses nach Spiritualität zu schrumpfen.
Aber das ist nicht einmal was mir am meisten an dem Begriff misshagt. Ich hatte bereits im Kapitel über Erstbegründung kurz erwähnt, dass es immer schon zwei Bewegungsrichtungen zu Gott gab, eine helle und eine dunkle. Die dunkle möchte das Weltgeheimnis vergrössern, die helle will es verkleinern. Spiritualität erachte ich letztlich als Fürwort für die dunkle Strömung.
Das Wort meint eine Geisteshaltung, die zwar als „fragend“ sich gebärdet (fragend zB. nach dem Sinn das Seins), dann aber keine Antworten akzeptieren will. Spiritualität kommt es nämlich auf die Frage an anstatt auf die Antwort. Recht eigentlich dann darauf, deren Unbeantwortbarkeit zu schützen. Sie will durch die Unbeantwortbarkeit der Fragen, die sie an die Welt stellt, deren mystische Seite nicht nur bewahren, sondern sogar betonen und erweitern. Ziel von Spiritualität, gerade indem sie fragend sich gibt, ist Rätselhaftigkeit.
Es gibt eben immer Leute, denen kann die Welt nicht mystisch genug sein. Hinter allem soll ein tieferer Sinn walten, durch jeden Gegenstand eine Seele wirken, in jeder Handlung ein Symbol aufscheinen.
Mag sein, das ist nur eine andere Ausprägung des Lichtenbergschen Ursachentiers. Aber mir gefällt sie nicht. Ich habe nichts gegen Geheimnisse; ich liebe sie. Auch bin ich kein Fortschrittsverklärer, der an die prinzipielle Beantwortbarkeit aller Fragen glaubt. Wir selbst werden uns in der Verworrenheit unserer Handlungsgründe wahrscheinlich immer ein Geheimnis bleiben, von anderen ganz zu schweigen. Jedoch, bei aller Unerklärlichkeit in und um uns, fühle ich mich dennoch äusserst unversucht, mich im Weltgeheimnis zu suhlen und in allem und jedem einen Beweis von Mystik, Fatum und Transzendenz zu suchen.
Im Gegenteil. Es gibt, und mir zur Freude, ein Reich der Antworten, ein Reich des Lichtes und der Helle. Immer wieder vermag der Mensch, Fragen auf eine Weise zu beantworten, die ihr Geheimnis entweder ganz und gar verschwinden lässt – oder auf ein neues Geheimnis verweist. Oftmals auch verliert der Mensche einfach das Interesse an bestimmten Geheimnissen. Sie kommen – wie der Paradiesglaube – einfach aus der Mode. Gibt es einen besseren Beweis dafür, dass die Welt mitunter weniger rätselhaft ist, als man glaubt; das vielmehr der Mensch es zu lieben scheint, sie mit Rätselhaftigkeit aufzuladen? Wie ein Berg dem Bewegungsdrang seiner Muskeln Befriedigung schaffen kann, kann ein Rätsel dem Denkdrang seines Hirns frommen.
Es ist uns, will ich sagen, möglich, Berge zu klimmen und Geheimnisse zu entschlüsseln. Ob die Gesamtmenge aller Geheimnisse durch unsere entschlüsselnde Tätigkeit kleiner oder größer wird, weiß ich nicht; die Gesetze der Thermodynamik wollen eigentlich, dass sie eher grösser, denn kleiner werden.
Und wenn schon. Mich stört das nicht. Entscheidender als ihre Anzahl ist ja, welche Geheimnisse wir lüften. Ausserdem geht es in der Regel nicht um die Lösung selbst, sondern eher um die Tätigkeit des Lösens. Das Ausderweltbringen von Geheimnissen befriedigt sehr, auch wenn dadurch neue Geheimnisse entstehen.
Das ist eine Art Spiritualität, die ich dem herkömmlichen Gebrauch dieses Wortes entgegen setzen möchte: Dinge in einen sinnhaften Zusammenhang bringen und dadurch ihr Geheimnis schmälern; dem Geheimnis seinen Ort zwar lassen, es aber nicht unnötig aufweiten wollen.
Fügen wir dem Ockhamschen ein Effisches Rasiermesser hinzu. Es lautet: Schaffe keine unnötigen Geheimnisse! Würdige eine Antwort, selbst wenn Sie nur einen Teil Deiner Fragen beantwortet! Begrüsse Antworten, die von einem grossen Geheimnis auf ein noch grösseres verweisen! Strebe, mit einem Wort, nach Erhellung, anstatt nach Verdunkelung!
Das ist der Geist, in dem ich diesen Aufsatz schrieb, das ist ein Gutteil seines Ansinnens. Nicht von der Existenz Gottes habe ich reden wollen, sondern lediglich von der Existenz seiner Notwendigkeit; ich wollte nur weisen, wo er entbehrlich sein kann und wie wenig wir seiner in zentralen Gottesbelangen tatsächlich benötigen.
Es ging um die Ermutigung, dass der Verlust Gottes sehr viel weniger schlimm ist, als ein Gläubiger befürchten mag. Meist verwechselt er ohnehin nur die Existenz seines Glaubens an Gott mit der Existenz Gottes selbst. Dem Verlust entgegen aber steht der Gewinn einer gewissen Gelassenheit gegenüber dem Absoluten. Das Absolute, meine ich, mag seinen Reiz ausüben, aber es ist im Grunde wenig fruchtbar. Man kann es eigentlich nur anstaunen. Fruchtbar ist das Irdische, Wandelbare, an dem der Mensch tätig seine Welt verbessern kann und dadurch (Wirk)erfahrung und Einsicht in die Konsequenzen seines Handelns erlangt. Daraus lernt er, meine ich, weit mehr als durch dessen Beurteilung in Hinblick auf Gott.
Man kann nun einwenden, daß ich Gott, der doch eine kompakte Vorstellung ist, nun in eine ganz ausgefranste, in tausend Richtungen weisende Angelegenheit verunstaltet hätte: Und allen Ernstes behauptete, dass diese Zerfaserung besser wäre, als die ursprüngliche, natürliche, naheliegende Annahme eines Gottes.
Eben darauf wollte ich hinaus. Gott, sage ich, ist nichts Kompaktes. Er ist nie etwas Kompaktes gewesen! Gott ist keine Einheit von Eigenschaften, kein Bündel zusammengehöriger Merkmale, nichts Ausserbegriffliches und kein Eigenname. In Wirklichkeit war Gott schon immer zerfasert und vielgestalt im Fühlen und Denken von ganz unterschiedlichen Menschen; er wies von Anbeginn in all die ausgeführten Richtungen; und noch in viele weitere. Ich habe ihn gar nicht verwandelt. Ich habe ihn nur in der Christenmenschen eigenen Ansichten näher beschrieben.
Es ist wie mit jeder fernen Ansicht einer Sache. Ich habe das Bild nur schärfer gestellt. Die Sache bleibt die selbe. Man kann ihre Details erkennen. Was aus der Ferne zusammenhängend und glatt erscheint, erweist sich aus der Nähe als vielfältig, untergliedert und weit auseinander liegend. Der Vorschlag dieses Aufsatzes liegt einzig darin, anstatt über eine ungefähre Fernsicht, über die schärfere Nahsicht auf Gott zu streiten.
———-
PS: Zum Anlass des Textes; es schreibt ja selten einer gänzlich unveranlasst. In dem Fall war es der Leserbrief eines gewissen Robert Deinhammer, Jesuit aus Innsbruck, den der 2011 im österreichischen „Standard“ veröffentlicht hat. Der Artikel wiederum wurde mir durch Dieter Sturm auf facebook (am 14.8.) zu Kenntnis gebracht; daraus entspann sich eine kleine Diskussion und aus dieser obiger Aufsatz. Der Leserbrief ist mE. größtenteils Kokolores und eignet sich bestenfalls zur Illustration der Art, in der Atheisten und Gläubige in der Regel aneinander vorbei reden. Es ist eben immer der Sumpf, aus dem was wächst, das war schon bei Heinrich Faust so…
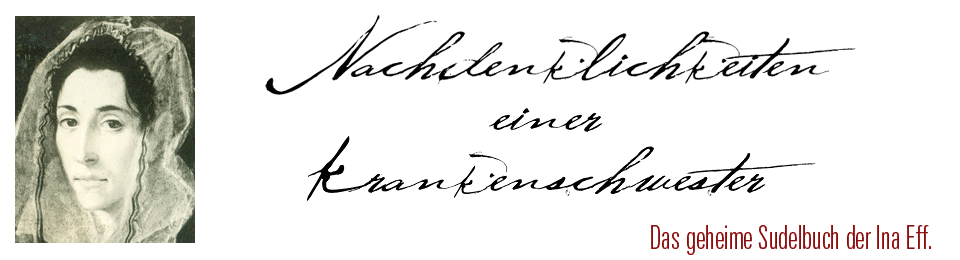
Kommentar vor Beendigung der Lektüre —
— gutes Thema, ausgezeichnet behandelt. Aber geht es nicht kürzer?
(Gleichwohl werde ich es zu Ende lesen. Später. Ich trotze dem Schmerz.)
Nachdem ich meine Gedanken geschüttelt und gerührt habe, nun meine Einwände.
1) Mich stört die unausgesprochene Gleichsetzung von Religiosität und Christentum — ein Nebeneffekt des Alleinvertretungsanspruchs der Kirche, der das Urteilsvermögen selbst des Agnostikers offensichtlich eintrübt.
2) Denn Religion ist auch der Glaube des alten Ägypten, das immerhin eine zeitweilige Weltmacht darstellte.
3) Mich stört, dass dem Christen unterstellt wird, er nutze die Frömmigkeit als Preis für das ewige Leben nach dem Tode. Der Mensch, und auch der Christ, ist kein reiner homo oeconomicus. Sondern ihm ist Kollegialität, Kooperation und Hilfsbereitschaft ebenso ein intern angelegter Grundtrieb wie der Überlebenswille. Beweis? Die Entwicklung der Menschheit. (Aus der Nähe fällt es vielleicht nicht so auf.) — Bei Marx‘ Sinnbild der „Religion“ als „Opium fürs Volk“ ist zu berücksichtigen, dass zu seiner Zeit Opium ein legal käufliches, aber teures Beruhigungsmittel war. Seine begründete Verachtung für das Christentum basiert aber nicht auf seiner Wirtschaftsanalyse, sondern auf der Ignoranz der Christenheit.
4) Und schließlich ist das Christentum der Ideologieträger des beginnenden Feudalismus, das die Wirtschaftsbasis der Sklaverei ablöste durch Lehnsherrschaft. Insofern ist selbst dem Christentum der Freiheitsgedanke immanent.
Lieber Wolf-Dieter,
ich gebe all Ihren Einwänden sofort statt. So lange man überhaupt etwas sagen will, muss man es missverständlich sagen. Unmissverständlich schreiben nur Mathematiker. Und die sagen nichts, nichts ausser Tautologien.
Also ad 1 und 2. Ich fokussiere ja schon im ersten Satz auf das Christentum. Meine Auseinandersetzung ist ganz und gar eine mit dem Christengott. Mit anderen Worten, die Gleichsetzung von Religiosität und Christentum betreibe ich ausgesprochen ausgesprochen. Alle Gottes-Eigenschaften, die ich behandle, sind Eigenschaften des Christengottes.
Natürlich gibt es andere Götter und sogar Religiosität ohne Götter (eg. Buddhismus), wiewohl über letzteres vielleicht Strittigkeit herrscht. Mein Problem ist, ich weiss von diesen fremden Göttern wenig. Schon über Jahwe kann ich nur dünnes Zeug reden. Von Ra oder Isis und anderen ganz zu schweigen. Weswegen ich von denen, nunja, geschwiegen habe.
Was nicht heisst, sie verlohnten keiner Betrachtung. Ich meine nur, wenn beim Betracht dieser Götter ähnliche Eigenschaften zur Sprache kommen sollten, etwa Transzendenz oder Letztbegründung, dann kann man die oben vorgetragenen Argumente in Betracht ziehen. Im Fall diese Götter ganz andere Eigenschaften haben, zum Beispiel Zelos, der griechische Gott des Eifers, der Neid und Eifersucht in die Welt bringt, müsste natürlich ein anderer Betracht geführt werden. Wie überhaupt die griechischen Götter von recht anderer Machart sind, als der Christengott. Sie stehen ja eher als Ursachen und Paten von Phänomenen, welche die Griechen als ewig erkannt hatten. Ansonsten, und abzüglich ihrer Unsterblichkeit und magischen Kräfte, sind sie doch recht menschlich geraten.
Um die Sache zu beschliessen. Wofern Religiosität auf etwas Göttliches weist, und dieses Göttliche wiederum Attribute der vorgetragenen Sorte meint (Trost, Letztbegründung, Substanz und Transzendenz), kann mein Aufsatz etwas beitragen. Ich setze Religiosität und Christentum ausgesprochen und nur in diesem Aufsatz gleich, und zwar in dem Sinne, als ich beanspruche, dass, wo immer diese Aspekte von Göttlichkeit besprochen werden, auch meine oben gebrachten Argumente etwas wiegen könnten. Sie sollen diesen Gottesattributen nur ein wenig die Göttlichkeit nehmen.
Ad 3) Die Unterstellung dieses Handels – Frömmigkeit gegen Leben nach dem Tode – haben Sie eher hinein gelesen, als ich hinein geschrieben. Jedenfalls war es meine Absicht nicht, solches zu suggerieren. Sofern schenke ich Ihnen diesen Einwand gern.
Ad 4) Das Christentum als „Ideologieträger des beginnenden Feudalismus“ zu bezeichnen, will mir sehr eng scheinen. Die Folgerung aber, es sei ihm der Freiheitsgedanke immanent, unterschreibe ich gern. Gleiches gilt übrigens für den jüdischen Gott Jahwe, der ganz explizit seine Allmacht beschränkt, um (a) die Welt überhaupt zu schaffen (sog. Tzimtzum) und (b) dem Menschen Willensfreiheit zu gewähren.
Warum mir diese Charakterisierung des Christemtums zu eng erscheint? Nun, erstens weil das Christentum zu vorfeudaler Zeit entstand. Zweitens, weil es in bislang jeder herrschenden Gesellschaftsform Fuss gefasst hat, von der Sklaverei bis zum Sozialismus. Drittens, weil ich nicht weiss, welches der Unterschied zwischen Ideologie und Ideologieträger sein soll. Viertens, weil Religiosität und Gottesgläubigkeit ebenso Dinge der Psychologie und allgemeiner menschlicher Geistestätigkeit, wie sie Ausdruck bestimmter gesellschaftlicher Formationen sind; es fällt, will ich sagen, dem Menschen sehr leicht, religiöses Fühlen und Denken in sich aufkommen zu lassen.
Die Frage ist weniger nach der politischen Instrumentalisierung dieser Fähigkeit, sondern welche Gedanken- und Gefühlskomplexe da fast automatisch agglomerieren und zur Religiösität sich verbinden? Ich verweise einmal beiläufig auf Personenkult oder Epiphanien, die mit Kunst- oder Drogengenuss einher gehen etc. Solche Phänomene tragen bereits wesentliche Merkmale von Religiösität, natürlich in jeweils ganz unterschiedlicher Ausprägung. Aber es werden in jedem Fall Dinge wie Transzendenz oder Substanz gestreift. Wenn dann noch hinzu tritt, dass diese Erfahrungen nicht privat bleiben, sondern gemeinschaftlich gemacht werden und organisiert werden, sind wir bereits sehr nahe an der Religiosität.
Ich kenne Marxens Gedanken zur Religion nur recht unvollständig. Soweit ich mmich erinnere, hat er sie als eine Art notwendigen Trost der Geknechteten gesehen, der aber seine Notwendigkeit verlöre, sobald es keine Geknechteten mehr gäbe. Religiösität (die wahrscheinlich auch bei ihm sehr christlich definiert war), war ihm also eine Art Sklavenbewusstsein.
Ich finde, das ist ziemlicher Zinnober. Nicht allein übersieht diese Sicht, dass es zu allen Zeiten sehr religiöse Herrscher gab, sondern auch, dass Religiösität eben eine Menge anderer Eigenheiten des Menschseins anspricht, die ganz unabhängig vom Herrschen oder Beherrschtsein Bestand haben.
Es ist sozusagen immer für jeden etwas dabei. Der Herrscher hat die Möglichkeit die Bedeutung seiner Taten ins Göttliche zu steigern, der Beherrschte findet Trost und ein Gerechtigkeitsversprechen; beide haben die Möglichkeit, ihr allgemeines Sehnen zu hypostasieren und in ein vereinheitlichtes Konzept zu giessen; das Erhabene findet seinen Ort und die Welt ihren Grund.
Diese Vielgestalt von Religiösität wollte ich weisen. Sie ist auch der Grund, aus dem Religiosität so anpassungsfähig ist. Kaum wirft man sie zu einer Tür hinaus, kommt sie durch eine andere wieder hinein. Und wir erkenen sie noch nichteinmal als das, was sie ist, weil sie neue Kleider trägt. Sie erscheint dann vielleicht Wissenschafts- oder Marktgläubigkeit, als Personenkult, als Esoterik etc. Oder als Mischform dieser und anderer Phänomene.
Soweit zunächst meine Stattgabe Ihrer Einwände.
Wie wäre es, anstatt über Gott zu streiten, ihn einfach zu akzeptieren? Ich hatte bei Ihrem (sehr klugen) Aufsatz den Eindruck, dass sie gar nicht Gott beschreiben, sondern dessen vielfache Spiegelungen in den Denkfiguren der Christen.
Noch eine kleine Anmerkung: Spiritualität als eine Vergrößerung des Dunklen anzusehen, das leuchtet mir nicht ein: „Spiritus“ ist doch der Geist, und diesen wiederum empfinde ich als etwas sehr Leuchtendes. Sicher leuchtet Spiritualität in anderen Farben als die – natürlich ebenfalls leuchtende – klare Welt der Begriffe. Umso besser: Je bunter das Denken, je vielgestaltiger, desto mehr Erkenntnis. Nicht immer bringt die Einigung auf ein gemeinsam akzeptables Denkmuster, wie sie ja Ziel jedes Streits, jeder Diskussion sein muss, zu einem Mehr an Erkenntnis.
Akzeptieren im Sinne von „Gott existiert, Diskussion erledigt“? Richtig verstanden?
Eher im Sinne von: „Das muss ich jetzt nicht verstehen, wie du denkst, und ich hab keine Lust, mich in deine komischen Denkmuster reinzuarbeiten. Lass uns einander begegnen, anstatt einander zu analysieren. Ich freu mich auf deine Ideen im Hier und Jetzt – deine Beweggründe dafür sind mir letztendlich egal.
Pingback: Boviste und Planeten, Nachtrag. | Nachdenklichkeiten einer Krankenschwester
http://www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html?_r=2&adxnnl=1&adxnnlx=1415727315-pCXR9NUmWeBxo+FViR+NlA
Yo!